
Widerstand gegen freien Fluss von Polizeidaten

Die EU-Kommission fordert den völlig freien Austausch von Polizeidaten in Europa. Für Schengen und damit für die Schweiz gilt die Initiative nicht.
Ein ähnlicher Vorschlag für den Schengenraum ging den Teilnehmerländern zu weit. Am Mittwoch debattierten sie über die umstrittene Initiative und schwächten sie ab.
Innerhalb der Europäischen Union (EU) sollen die Polizeikorps der Mitgliedsstaaten ihre Daten rasch und unkompliziert austauschen. Dies forderte am Mittwoch EU-Justizkommissar Franco Frattini: «Die blosse Tatsache, dass strafverfolgungs-relevante Informationen Grenzen überschreiten, soll in Zukunft keine Rolle mehr spielen.»
Den grenzenlosen Fluss von Polizeidaten will die EU-Kommission mit einem Beschluss ermöglichen, dem die Mitgliedstaaten noch zustimmen müssen. Tun sie dies, dann werden die Polizeikorps ihre Schubladen für die Kollegen in anderen EU-Ländern sowie für Europol sehr weit öffnen müssen: Auskunftsverweigerung wäre nur noch in seltenen Fällen möglich.
Ähnliche Initiative im Schengenraum
Dieser Vorschlag wirft heikle Datenschutzfragen auf. Die Schweiz betrifft er aber nicht, weil er nicht im Rahmen von Schengen umgesetzt werden soll. Aber auch für den Schengenraum ist eine ähnliche Initiative der schwedischen Regierung hängig.
Gemäss dem ursprünglichen Vorschlag hätten die Schengenländer, zukünftig also auch die Schweiz, ebenfalls fast alle polizeilichen Informationen teilen müssen – auf einfache Anfragen hin und ohne Rechtshilfeverfahren.
Dies ging der Schweiz, aber auch anderen Ländern, entschieden zu weit. Am Mittwoch debattierten die Innenminister der Schengenländer die umstrittene Initiative in Luxemburg – und entschärften sie. Laut dem Schweizer Delegationsleiter und Botschafter bei der EU, Bernhard Marfurt, zeichnete sich eine Einigung auf einen Kompromissvorschlag der britischen Präsidentschaft ab.
Flexiblere Lösung
Die Lösung der Briten ermöglicht mehr Flexibilität: Die Schengenländer müssen nur so weit Daten liefern, wie es ihre bisherige Rechtsordnung gestattet. Die Schweizer Polizei wird zum Beispiel keine Informationen weiter geben, die aus Verhörprotokollen oder Hausdurchsuchungen stammen.
Denn solche Informationen können innerhalb der Schweiz auch die kantonalen Polizeikorps nicht einfach so austauschen, in der Regel muss dies ein Untersuchungsrichter anordnen.
Schon bisher war es für die Schweizer Polizei dagegen unproblematisch, Angaben aus Telefonbüchern oder über Fahrzeughalter an ausländische Kollegen weiter zu geben. Wenn dies nun auch in anderen Ländern einfacher werde, könne dies die Zusammenarbeit vereinfachen, sagte die Vizedirektorin des Bundesamtes für Justiz, Monique Jametti Greiner.
Sehr zufrieden mit dem Ergebnis war Roland Krimm, der Informationsbeauftragte der Kantone in Brüssel: «Es zeigt, dass die Schweiz mit klaren und fundierten Positionen in der Schengen-Mitsprache viel erreichen kann.»
swissinfo, Simon Thönen, Luxemburg
Als Gegengewicht zum verstärkten Datenaustausch hat die EU-Kommission einen besseren Datenschutz vorgeschlagen, der auch für die Schengenländer gelten soll.
Die heutigen EU-Regeln zum Datenschutz greifen bisher ausgerechnet im besonders sensiblen Polizei- und Gerichtsbereich kaum.
Mit der neuen Regelung soll der Polizei zum Beispiel das Sammeln von Angaben über politische Ansichten oder die Religionszugehörigkeit verboten werden.
Doch Ausnahmen sollen erlaubt sein, wenn sie für die Verbrechensbekämpfung unbedingt notwendig sind.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards











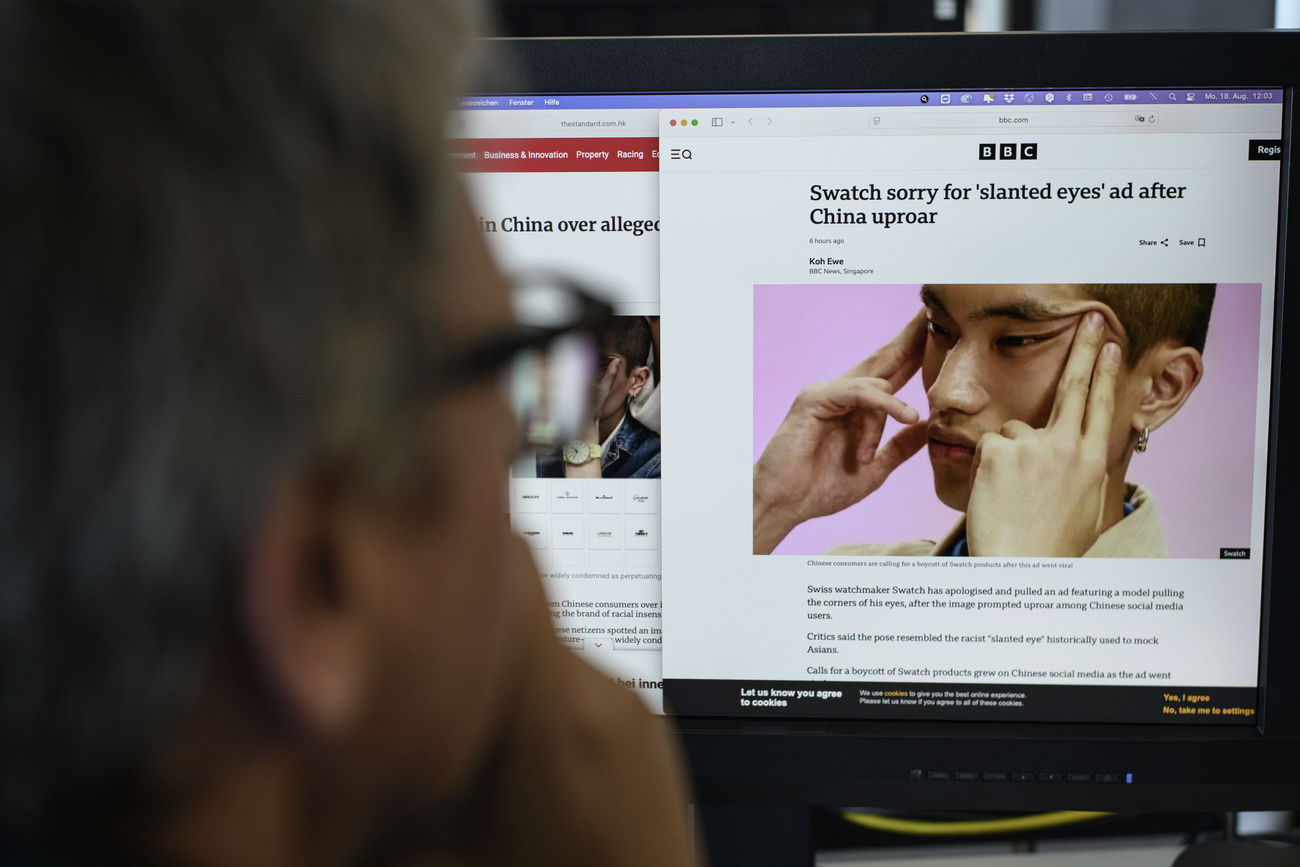






















Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch