Gotthelf: Gefeierter Bauern-Shakespeare

Im Gotthelf-Jahr 2004 wurden im Emmental unter dem Motto "Auf dem Weg zum Original" rund 150 Veranstaltungen organisiert, die Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf würdigen.
Dies zeigt, dass der Dichterpfarrer Jeremias Gotthelf auch 150 Jahre nach seinem Tod nichts an Aktualität verloren hat.
In Lützelflüh, dem Ort von Gotthelf Wirkens als Pfarrer und Dichter, findet am 23. Oktober als eine der letzten Veranstaltungen die offizielle Gedenkfeier seines Todes statt. Dort war am 4. April auch das Gedenkjahr von Bundesrat Samuel Schmid eröffnet worden.
Am 22. Oktober 1854 starb Jeremias Gotthelf, einer der bekanntesten Dichter der Schweiz. Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf untersuchte und beschrieb in seinem aus 13 Romanen und 75 Erzählungen bestehenden Werk die Spannungen zwischen alt und neu, Agrarzeitalter und industrieller Revolution, bäuerlichem und städtischem Bereich.
In den Zeiten der Helvetischen Revolution
57 Jahre vorher wurde Bitzius in Murten als Sohn des Pfarrer Sigmund Bitzius und der Elisabeth, geb. Kohler geboren. Schon bald nach seiner Geburt erschütterte die Helvetische Revolution die Schweiz.
Damit fand die jahrhundertelange Herrschaft der Patrizierfamilien in den grossen Städten über die Landbevölkerung ein gewaltsames Ende. Napoleon besetzte mit seinen französischen Truppen die Schweiz.
Das Vorbild Pestalozzi
Das Umfeld des kleinen Albert war also eher von Konfusion denn Beschaulichkeit geprägt. Dass Albert einmal Schriftsteller werden würde, schien ihm nicht in die Wiege gelegt worden zu sein.
Einer seiner Lehrer beklagte sich einmal: «Er schreibt wie eine Sau, lässt er mal was drucken, so hat er Schinders Verdruss.» Mutter Bitzius meinte darauf, das Schreiben werde Albert wohl bleiben lassen. Der Lehrer orakelte jedoch: «Me cha nie wüsse» (Man kann nie wissen) und behielt bekanntlich recht.
Zuerst aber wurde Albert wie sein Vater Pfarrer. Er stiess sich an den sozialen Zuständen und wurde deshalb Schul- und Sozialreformer. Das Schulwesen und die Erziehung waren ihm ein grosses Anliegen. Er war ein glühender Verehrer von Heinrich Pestalozzi.
Dichterischer Spätzünder
Pfarrer Bitzius musste allerdings 39 Jahre alt werden, um sich zum Schriftsteller Jeremias Gotthelf zu entwickeln. Sein erster Roman «Bauernspiegel oder Lebensgeschichte des Jeremias Gotthelf» von 1837 enthält bereits die Kernpunkte seines sozialen und politischen Programms.
Er entwarf darin ein Gegenbild zum romantisierenden Bauernbild des Biedermeier. Er stellte übliche Missstände wie korrupte Gemeindebeamte, das Verdingwesen und das Schulwesen schonungslos an den Pranger.
Gotthelf beschäftigte sich weiter mit der rechten Bauernart, der Sittlichkeit, Arbeit als Grundlage eines gesunden Wohlstands und natürlich der Gottesfurcht.
Schonungslose Kritik übte er an Bosheit, Eigennutz, Geiz und Habsucht, Konsum und Trunksucht. Er wandte sich auch dezidiert gegen Verschwendung und Ausbeutung.
Dem Genuss nicht abgeneigt
Zum Alkohol hat er ein ambivalentes Verhältnis. Obwohl er in seiner Erzählung «Wie fünf Madchen im Branntwein jämmerlich umkommen» engagiert gegen den Alkoholmissbrauch anschreibt, ist er privat einem guten Glas Wein durchaus nicht abgeneigt.
Sein deutscher Verleger berichtete sogar nach einem Augenschein der Gotthelfschen Weinvorräte: «Ein Weinkeller, wie er in Berlin selten sein dürfte.»
Bei seinen Kirchgängern war Gotthelf nicht sehr beliebt. Um nicht in seinen Büchern vorzukommen, gingen sie ihm lieber aus dem Weg. Es soll sogar zu tätlichen Angriffen gekommen sein.
Wenig geliebt
In seiner Kirche aber konnten ihm die Landleute nicht entkommen. Dies nutzte er erbarmungslos aus. Kurz bevor das Stundenglas jeweils das Ende der Predigt ankündigte und sich die Gemeinde schon auf den Frühschoppen in der Dorfbeiz freute, drehte er die Sanduhr noch einmal um mit den Worten «Dir möged gwüss no nes Glesli» (Ein Gläschen könnt ihr gewiss noch ertragen).
Geliebt wurde er nicht von der Bevölkerung im Emmental. Sein Tod 1854 wurde im Kanton Bern mit kaum einer Zeile gewürdigt.
Und die harten Lützelflüher Bauernschädel vergaben ihm, von dem sie sich in seinen Büchern infam verspottet fühlten, auch 35 Jahre nach seinem Tod nicht. Sie machten sogar Schwierigkeiten, als ein Gotthelf-Gedenkstein errichtet werden sollte.
swissinfo, Etienne Strebel
Jeremias Gotthelf war ein engagierter Mensch und kritisierte Misstände. Er wollte den Menschen einen Spiegel vorhalten und sie zur Selbsterkenntnis führen:
«Denn selbst sehen und erkennen können die meisten Menschen nicht, sie sind blind geboren, den Star muss man ihnen stechen. Mancher, im Unrat geboren, merkt ihn nicht, bis man ihm die Nase darauf stösst und ihm sagt: ‹Das stinkt›.»
«Ein Spiegel ist’s, doch nicht ein gemeiner, in dem ein jeder ein schönes Gesicht zu sehen glaubt. Mein Spiegel zeigt euch die Schatten- und nicht die Sonnenseite Eures Lebens.»

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards






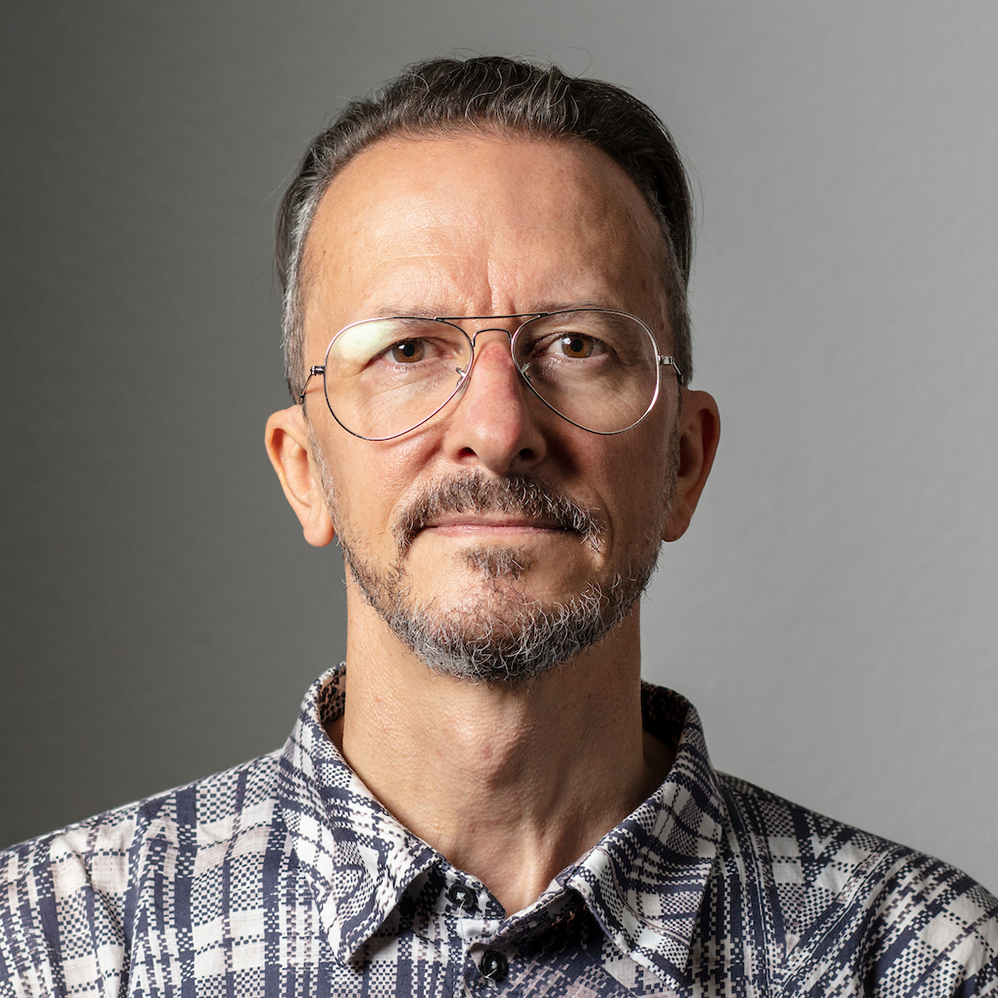





Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch