Schweiz riskiert Ausschluss aus europäischem «Cern für KI»

Die Europäische Union hat milliardenschwere Investitionen in die künstliche Intelligenz (KI) angekündigt, um ein "Cern für KI" zu schaffen. Die Einbeziehung der Schweiz, Heimat des weltberühmten Cern in Genf, könnte jedoch als Nicht-EU-Mitglied eingeschränkt werden.
«Wir wollen den Erfolg des Cern in Genf wiederholen», sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen auf dem AI Action Summit in ParisExterner Link im Februar.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Europäische Union (EU) 200 Milliarden Euro für den Bau von KI-«Gigafabriken» bereitgestellt, riesige hochmoderne Rechenzentren, die Europas technologische Infrastruktur stärken und die KI-Entwicklung beschleunigen sollen. Die Vision ist klar: Es soll ein «Cern für KI» entstehen.
Das Cern in Genf, die Europäische Organisation für Kernforschung, ist eine der renommiertesten wissenschaftlichen Einrichtungen der Welt und verantwortlich für bahnbrechende Entdeckungen wie das Higgs-Boson und die Erfindung des World Wide Web.
Das 1954 – Jahrzehnte vor der EU – gegründete Cern wurde bewusst in der Schweiz angesiedelt, um seine Neutralität und internationale Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Es ist nach wie vor ein Zentrum für Spitzenforschung in der Physik und beherbergt Anlagen wie den Large Hadron Collider (LHC), den leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der Welt.
Ein neues «Cern für KI» könnte eine ähnliche Rolle für die künstliche Intelligenz spielen, die globale Forschung prägen und neue Standards für maschinelles Lernen, Robotik und ethische KI-Governance setzen.
>> Die Herausforderungen für ein «Cern für KI»:

Mehr
Ist ein «Cern» für Künstliche Intelligenz eine gute Idee?
Die Schweiz an der Spitze der KI-Forschung
Im Gegensatz zum Cern könnte die Schweiz jedoch von diesem neuen europäischen Projekt ausgeschlossen werden. «Eigentlich richtet sich diese Initiative an EU-Länder», schreibt eine Sprecherin der Europäischen Kommission per E-Mail und ergänzt, dass der Verweis auf das Cern symbolisch sei und keine Rolle für die Schweiz impliziere.
Dies wäre ein Schlag für das Alpenland, das mehrere Millionen in Initiativen zur Beschleunigung der KI-Forschung investiert und sich mit einem neuen Supercomputer, dem siebtstärksten der Welt, ausgestattet hat.
Die Schweiz verfügt zudem über zwei starke Fachhochschulen und einen Talentpool, der Tech-Giganten wie Google, Microsoft und Open-AI angezogen hat. «Die Schweiz gehört zusammen mit dem Vereinigten Königreich zu den führenden Ländern Europas in der KI-Forschung», sagt Andrea Rizzoli, Direktor des Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence Studies (IDSIA) in Lugano.
Doch dies, so Rizzoli, werde nicht ausreichen, um der Schweiz einen prominenten Platz in der europäischen Initiative zu sichern: Die Beteiligung des Bundes werde massgeblich davon abhängen, wie es ihm gelinge, die Beziehungen zur EU zu verbessern.
Ausschlussgefahr für die Schweiz
Nachdem die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU im Jahr 2021 gescheitert waren, wird für diesen Frühling ein neues bilaterales Abkommen erwartet.
Seit Januar sind die Schweizer Hochschulen wieder in europäische Forschungsprogramme wie Horizon Europe aufgenommen worden, ein Zeichen der Annäherung zwischen Bern und Brüssel.
Sollte das Abkommen jedoch scheitern, würde die Situation wieder von vorne beginnen, so Rizzoli. Und die Einbindung der Schweiz in europäische KI-Projekte wäre gefährdet.
Rizzoli sieht auch das Risiko, dass die Schweiz aus geopolitischen Gründen von europäischen KI-Initiativen ausgeschlossen werden könnte. Die EU schliesst Nichtmitgliedstaaten bereits von Projekten in strategischen Bereichen wie der Cybersicherheit aus. «Das wäre das Worst-Case-Szenario», so der Experte.
Auch die Schweizer Politik könnte ein Hindernis darstellen. Obwohl Bern KI zu seinen Regierungsprioritäten zählt, hat es noch keinen Dialog mit Brüssel aufgenommen, um sich eine Rolle in den Plänen für ein «Cern für KI» zu sichern.
«Im Moment gibt es keine konkreten Gespräche über eine Beteiligung oder die Möglichkeit über ein Hosting dieser Einrichtung», so eine Sprecherin des von Bundesrat Albert Rösti geleiteten Eidgenössischen Kommunikationsdepartements per E-Mail.
Während des Pariser Gipfels hatte Rösti die Bereitschaft der Schweiz bekundet, den nächsten europäischen KI-Aktionsgipfel auszurichten. Doch die Befürworterinnen und Befürworter einer stärkeren Schweizer Beteiligung beliessen es dabei. Röstis Departement erklärte sich jedoch «grundsätzlich offen für solche Kooperationen».
Europäische KI: Warum die Schweiz und die EU einander brauchen
Laut Ricardo Chavarriaga, Leiter des Schweizer Büros der Nichtregierungsorganisation Cairne, die sich für die Schaffung eines europäischen Exzellenznetzwerks für KI einsetzt, sollte die Schweiz sich proaktiver für eine Schlüsselrolle in der globalen KI engagieren.
«Von einem wechselseitigen Austausch von Talenten, Kapital und Innovationen mit der EU würde die Schweiz stark profitieren», argumentiert der Experte. Bern würde nicht nur seine Position stärken, sondern sich auch Zugang zu einem grösseren Markt, wichtigen Halbleitern und europäischen Rechenzentren sichern.
Im Gegenzug könnte die Schweiz ihr exzellentes Ökosystem aus Forschung, kleinen und mittleren Unternehmen und technologischer Infrastruktur einbringen, das die Grundlage ihrer Wirtschaft bildet.
Dieses Modell stünde im Einklang mit der europäischen Strategie, die auf eine starke öffentlich-private Synergie abzielt und auch kleinere Unternehmen einbezieht. Es würde Europa zudem ermöglichen, sich von grossen Akteuren wie den Vereinigten Staaten zu unterscheiden, wo Big Tech den Sektor dominiert, so Chavarriaga.
Ist ein grenzenloses «Cern der KI» noch möglich?
In Brüssel sind sich gemeinnützige Organisationen, die den EU-Institutionen nahestehen, in einem Punkt einig: Der Erfolg jeder grösseren neuen KI-Initiative wird von der Einbeziehung von Nicht-EU-Ländern abhängen.
«Je grösser die Gruppe, desto erfolgreicher wird sie sein», sagt Max Reddel von der unabhängigen Denkfabrik Centre for Future Generations.
Das Zentrum setzt sich seit langem für die Schaffung eines «Cern für KI»Externer Link ein, um eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen: den Aufbau zuverlässiger und transparenter KI-Systeme.
Für Reddel ist dies eine einzigartige Gelegenheit für Europa, eine ethische Entwicklung der KI voranzutreiben – ein Bereich, auf den sich die USA und China nicht konzentrieren. Um dies zu erreichen, darf sich die EU jedoch nicht isolieren.
>> China fordert die USA und Europa bei der Regulierung und Entwicklung von KI heraus. Die Schweiz will vermitteln:

Mehr
Könnte Chinas Umgang mit KI ein Vorbild für die Schweiz sein?
Im Gegensatz zum Cern in Genf, das sich auf die Grundlagenforschung fokussiert, wird sich das neue KI-Zentrum der EU auch auf die Innovation und die Technologieproduktion konzentrieren, Bereiche, die Europa – einschliesslich der Schweiz – noch stärken muss.
Aus diesem Grund sieht das Projekt anstelle eines einzigen Hauptsitzes ein Netzwerk strategischer Zentren vor, das die Ressourcen auf die Mitgliedstaaten und private Partner verteilt.
Reddel betont, dass die Schweiz nach den Gesprächen in Brüssel weiterhin im Spiel sei: Die Standorte seien noch nicht festgelegt und die Forschung könne überall stattfinden
Die EU erkennt den Wert der Schweiz als wissenschaftliche Partnerin bereits an, wie die Zusammenarbeit im Rahmen des Programms Horizon Europe zeigt.
Andrea Rizzoli vom IDSIA betont jedoch, dass nicht die Wissenschaft, sondern die Politik über die Rolle der Schweiz entscheiden werde.
«Der Zugang der Eidgenossenschaft zu dieser Initiative wird einzig und allein von politischen Entscheiden abhängen», sagt er. «Und auch wenn die Wissenschaft keine Grenzen kennt, so kennt die Politik viele.»
Editiert von Gabe Bullard, Übertragung aus dem Englischen mit der Hilfe von Deepl: Petra Krimphove/raf

Mehr
Die Maschine und die Moral

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards











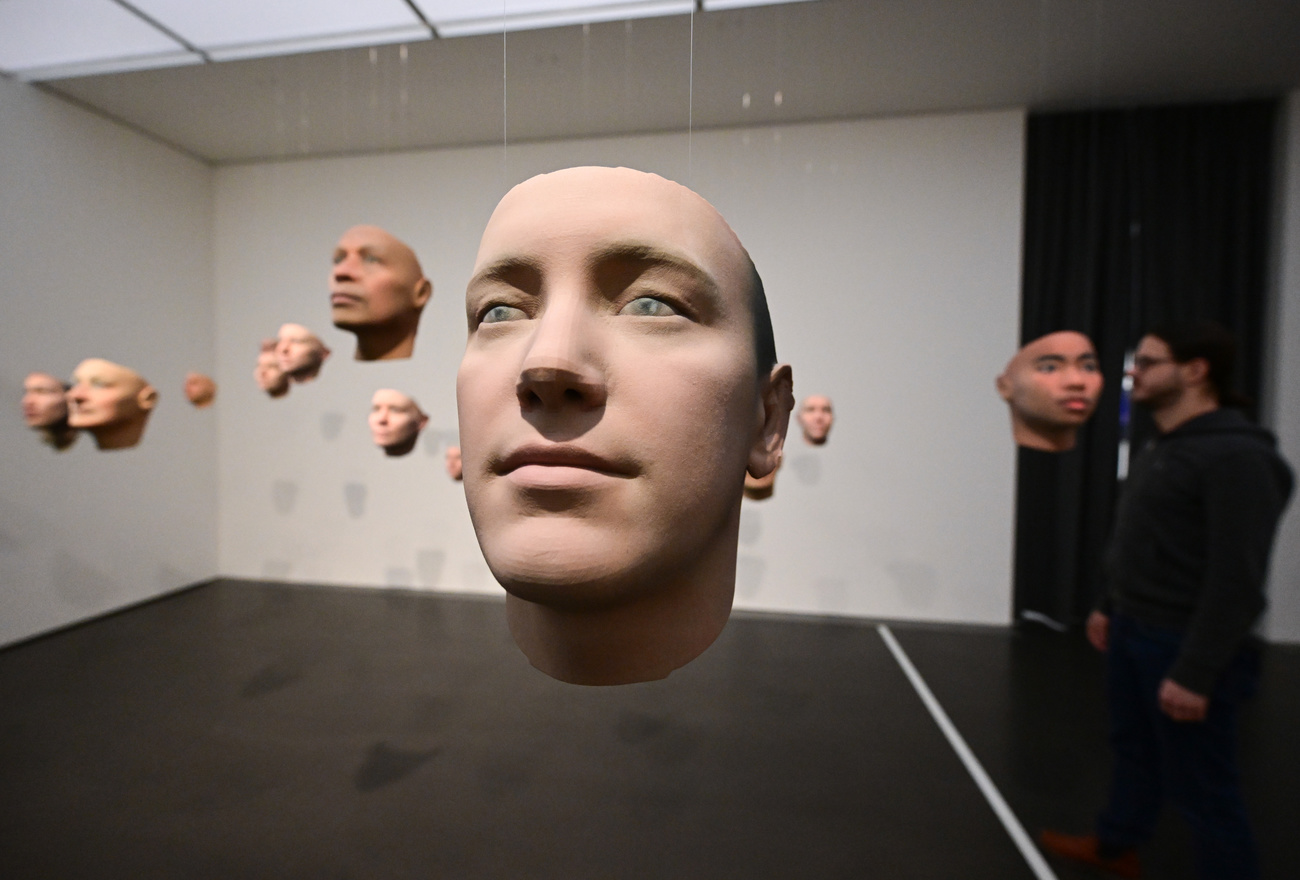

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch