
UNO: Die Welt ist zum Dorf geworden

Nach der Schweizer Regierung und der Kleinen Kammer beschäftigt sich nun auch die Grosse Kammer mit der Initiative für den Beitritt der Schweiz zur UNO. Dies unter anderen Rahmenbedingungen: Nach den Terroranschlägen in den USA ist die Welt nicht mehr die alte.
Wer vor dem 11. September 2001 für den UNO-Beitritt war, ist es noch heute. Und wer dagegen war ebenfalls. Doch zu den altbekannten Argumenten kommen neue hinzu.
«Alt» ist das Abseitsstehen der Schweiz als einziges Land ausser dem Vatikan. «Alt» ist auch das Argument, dass die Schweiz nicht mehr nur zahlen soll, sondern auch mitbestimmen.
Das Gegenargument der gefährdeten Neutralität taucht wie vor dem 11. September von der rechtsbürgerlichen Seite immer wieder auf. «Neu» ist der häufige Bezug auf Terrorismus.
Gemeinsam ist man stärker
«Der schreckliche Terroranschlag in den USA zeigt, wie nötig Gemeinschaft, gemeinschaftliches Handeln ist», eröffnete der Sozialdemokrat Remo Gysin die Debatte. Terrorismus sei ein weltweites Verbrechen, dem kein Land allein vorbeikommen könne. «Die UNO hat ihren Tätigkeitsschwerpunkt dort, wo die Ursachen von Terror, der Nährboden des Terrorismus liegt, nämlich in der Bekämpfung der Armut, des Rassismus, der Diskriminierung.»
Bereits 1972 habe die UNO Ansätze gegen Terrorismus erarbeitet, 1994 eine Anti-Terrorismus-Erklärung abgegeben, der zwei Übereinkommen folgten. «Die Katastrophe von New York, Washington und Pittsburgh verdeutlicht die Notwendigkeit der Vereinten Nationen leider auf sehr brutale Weise.»
Die UNO ist nicht perfekt
Dem entgegnete Ulrich Schlüer von der Schweizerischen Volkspartei (SVP): «Diese Organisation hat es, obwohl sie schon Resolutionen zur Thematik verfasst hat, bisher nie geschafft, wenigstens solche Länder, die auf ihrem Territorium überführte Terroristen beherbergen, ihrer Mitgliedschaft in der UNO mindestens zu suspendieren.» Die UNO sei eine Organisation, an der nur die Bürokratie ein Interesse habe. Aber einem Beitritt dürfe die Neutralität nicht geopfert werden.
Dass die UNO keine perfekte Organisation ist, wurde in der Debatte weithin anerkannt. Die Frage, weshalb sie keine Kriege verhindern könne, sei berechtigt, so Rosmarie Zapfl von der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP). Die Antwort: «Die UNO ist weder Weltregierung noch Militärallianz.» Die heutige, aktuelle Situation in Amerika brauche eine kollektive Sicherheitspolitik. «Ein Land alleine kann das nicht mehr meistern. Und die Schweiz hat sich in der UNO über all die Jahre hinweg stark gemacht zur Erarbeitung von Instrumenten gegen den Terrorismus. Wer denn sonst, wenn nicht die UNO kann sich dagegen stark machen?»
Nicht perfekt war die UNO auch nach den Anschlägen in New York und Washington. Der Freisinnige Pierre Triponez vermisste danach beispielsweise einen Auftritt des UNO-Sicherheitsrates. Trotzdem befürworte er einen Beitritt der Schweiz, wenn ein Neutralitäts-Versprechen deutlich vorhanden sei.
Meinungsäusserung ohne Worte
Die Meinung zur UNO wurde im Nationalratssaal nicht nur mit Worten kund getan. Die Grüne Pia Hollenstein trug bei ihrem Votum etwa ein T-Shirt mit allen Flaggen der UNO-Mitgliedsstaaten. Die quadratische Schweizer Fahne fehlte. Sie schäme sich für jegliche Abschottungs-Mechanismen.
SP-Nationalrätin Anita Fetz fiel durch ihr knallrotes T-Shirt mit weissem Kreuz auf. Sie sei Patriotin und damit gegen eine egoistische Neutralität. «Es gibt keine Neutralität gegen Menschenrechtsverletzungen und Terror, sondern nur Feigheit, wenn man abseits steht.»
Verletzliche Welt
«Probleme machen längst nicht mehr vor Landesgrenzen halt», ist Lili Nabholz-Haidegger (FDP) überzeugt. Deshalb müsse sich die Schweiz da äussern, wo ihr zugehört werde. Nicht einverstanden damit war Luzi Stamm (SVP). Die Terroranschläge gegen die USA hätten gezeigt, dass nach dem Wegfall des Kalten Krieges noch immer Gefahr bestehe. Terrorismus, der Nahe Osten und der Aufstieg Chinas stellten Konfliktpotenzial dar. Die Schweiz müsse humanitäre Hilfe leisten, unabhängig von der politischen Machtbühne.
Die neuen Argumente nach dem 11. September 2001 fasste das Votum der Freisinnigen Maya Lalive d’Epinay zusammen: «Wir sprechen heute über eine Frage, die viel mit dem zu tun hat, was letzte Woche in den USA geschehen ist. Und dieser barbarisch-geniale Akt, muss man fast sagen, wird unsere Wahrnehmung von dieser Welt, aber auch von uns in ihr verändern. Wir alle sind uns zum gleichen Zeitpunkt bewusst geworden, wie fragil unsere tägliche Sicherheit ist, aber auch wie eng wir alle auf dieser Erde verknüpft sind. Im Guten, aber eben auch im Bösen.»
Wir alle trauerten um Menschenleben, so Lalive, aber auch um ein Stück Menschlichkeit. Gezeigt hätte der Angriff, dass ein Staat allein Sicherheit nicht garantieren könne. Die Welt sei ein Dorf geworden. Man komme nicht umhin, gemeinsame verbindliche Grundwerte für alle Völker und Religionen zu definieren. Dies sei nur innerhalb der UNO möglich.
Die Diskussion ist noch nicht beendet, doch zeichnet sich auch im Nationalrat eine breite Zustimmung für die Initative ab.
Rebecca Vermot

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards












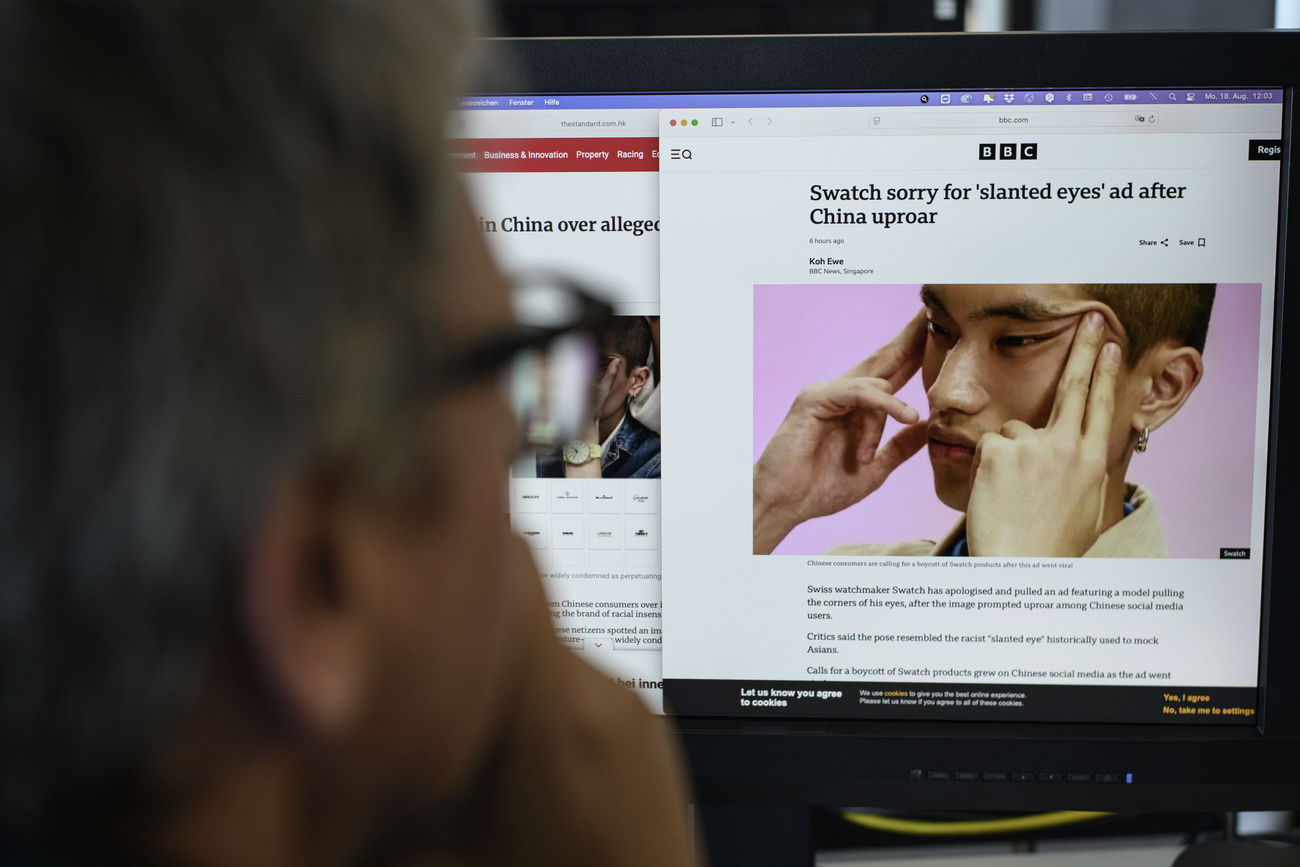




















Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch