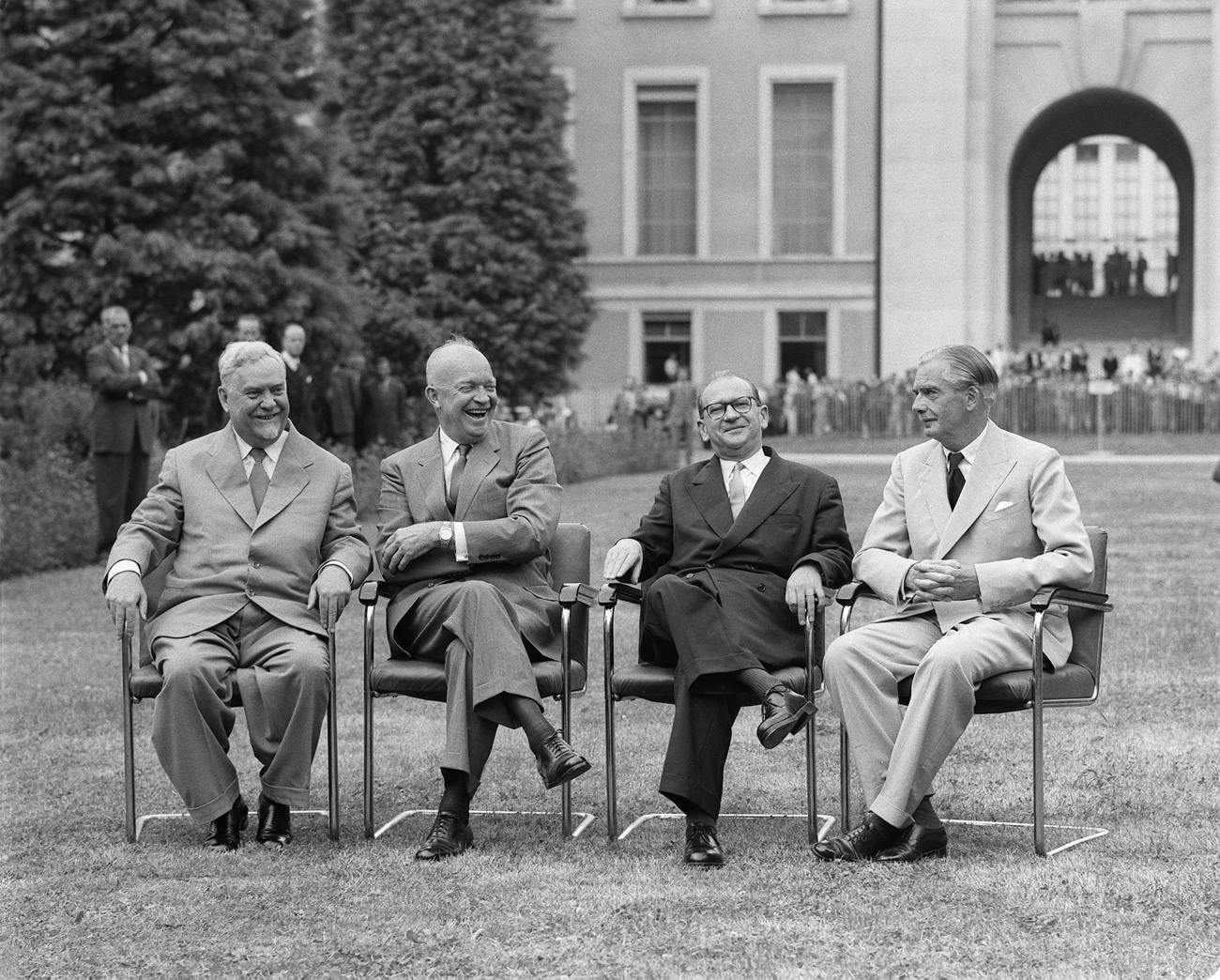
Ein Satellit beobachtet Basler «Dybli»

In Basel werden Tauben mit einem Satellitenempfänger bestückt, der das Tagesprogramm der Vögel aufzeichnet. Damit soll das Verhalten der Tiere studiert werden.
Ein Ziel ist, die Luftverschmutzung in den verschiedenen Stadtteilen vergleichen zu können.
In Basel gibt es bald einmal Tauben, die ein kleines Kästchen auf dem Rücken tragen. Es handelt sich dabei nicht um Brieftauben mit einem Rucksack. In der Box sind Daten gespeichert: Das ganze Tagesprogramm einer Stadttaube kann damit erfasst werden.
Was macht die Taube den ganzen Tag?
Seit etwa 20 Jahren wird in Basel Taubenforschung betrieben. Doch bis heute ist unklar, in welchem Aktionsradius sich die Vögel bewegen. «Wir möchten herausfinden, was eine Taube alles unternimmt, nachdem sie ihren Schlag am Morgen verlassen hat», sagt Daniel Haag-Wackernagel, Leiter der Forschungsgruppe für integrative Biologie des anatomischen Instituts an der Uni Basel.
In der Stadt Basel leben schätzungsweise 5000 bis 8000 Tauben. «500 davon leben in den acht Schlägen, die von uns betreut und beobachtet werden», so der Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Thema.
Tauben mit Satellitenempfänger
Der GPS-Empfänger (Global Positioning System), welcher die Ortung per Satellit erlaubt und beispielsweise bei Schiffen eingesetzt wird, soll Antworten auf diese Fragen liefern.
Die kleinen Wunderboxen, die alle zehn Sekunden die Position des Tiers aufzeichnen, wurden bereits mit Erfolg für die Erforschung von Brieftauben eingesetzt. «Die Kästchen werden auf dem Rücken der Taube montiert und begleiten das Tier während des Tags», so Haag-Wackernagel.
Am Abend, wenn die Tiere in den Schlag zurückkehren, werden die Empfänger abgenommen und mit Hilfe des Computers ausgewertet. «Wir können die Daten dann auf dem Stadtplan einzeichnen und so den Weg und Flug der Tauben mit genauen Zeitangaben nachvollziehen.»
Starke, aktive «Pilot»-Tiere
Dieser Versuch werde aufregende Tage und Nächte mit sich bringen: «Wenn eine Taube einmal ausserhalb des Schlags übernachtet, werden wir eine schlaflose Nacht haben und hoffen, dass ihr nichts zugestossen ist», vermutet Haag-Wackernagel.
Die Sender werden längstens zwei Monate auf der gleichen Taube befestigt bleiben. Danach wird ein anderes Tier erfasst. Für die erste Staffel wurden bereits vier geeignete Tauben ausgesucht – speziell starke und aktive Tiere.
Krankheiten besser kennen lernen
Das Tauben-Projekt hat verschiedene Ziele: So sollen damit Daten für ein Bio-Monitoring-Projekt des Uni-Instituts für Natur, Landwirtschaft und Umweltschutz (NLU) gewonnen werden. «Das NLU untersucht Basler Stadttauben auf verschiedene Substanzen, welche die Tiere durch die Luft und die direkt vom Boden aufgepickte Nahrung aufnehmen», erklärt Haag-Wackernagel.
Die Tauben atmen den ganzen Tag Stadtluft ein; mit den so erfassten Verschmutzungswerten könnten Rückschlüsse auf die Ablagerungen im menschlichen Körper gezogen werden.
«Ein Baby, dass noch nie Ferien auf dem Land verbracht hat, dürfte also ähnliche Belastungswerte aufweisen wie eine Stadttaube.» Allerdings sei es für genaue Vergleiche wichtig, ob die Taube sich nur in einem Quartier oder in der ganzen Stadt bewege.
Weiter sollen die Daten Rückschlüsse auf die Übertragung von Krankheiten möglich machen: Auch hier spiele der Aktionsradius bei ansteckenden Erregern wie beispielsweise der Ornithose (Papageienkrankheit) eine entscheidende Rolle, so Haag-Wackernagel.
Fütterungsverbot macht Schule
Seit Jahren wird in Basel immer wieder mit Kampagnen und Informationsbroschüren versucht, die Bevölkerung davon abzuhalten, die Tauben zu füttern.
«Natürlich verstehen wir, dass es grossen Spass macht, diese intelligenten Vögel zu füttern», räumt Tauben-Fan Haag-Wackernagel ein. Schliesslich würden sie bereits nach einigen Fütterungen ihren Wohltäter erkennen und bei ihm nach Futter betteln.
Allerdings schade das übertriebene Nahrungsangebot den Tieren nur. Die Populationen vergrösserten sich so ständig, was zu «Slum-artigen» Zuständen und zur Ausbreitung von Epidemien und Parasiten führe.
Sei das Futter hingegen knapp, müssten die Tiere viel Zeit für die Nahrungssuche verwenden und hätten weniger Zeit für die Aufzucht.
Das Fütterungsverbot in Basel wurde bereits von anderen Städten, gerade kürzlich von Luzern und Bern, übernommen.
Keine «Taubenmörder»
«Militante Tierschützer bezeichnen uns wegen dieser Taktik als Taubenmörder. Sie behaupten, die Tiere bewegten sich täglich nicht weiter als 100 Meter, fänden zu wenig Nahrung und verhungerten deshalb», erzählt der Taubenexperte. Aber das stimme nicht, man müsse nur in den Himmel schauen, dann sehe man Tauben, die einiges weiter als 100 Meter weit flögen.
«Damit wir dies wissenschaftlich beweisen können, brauchen wir ebenfalls die Daten der GPS-Empfänger.»
So liefert die Aktion wichtige Grundlagen für verschiedene Forschungsgebiete. Haag-Wackernagel: «Unser Hauptziel ist und bleibt aber, Tauben besser zu verstehen und mehr über das Leben dieser faszinierenden Tiere zu erfahren.»
Mena Kost
Die Forscher wollen mehr über den Aktionsradius der Stadttauben herausfinden. Neben besserem Verständnis für die Tiere geht es unter anderem darum zu belegen, dass die Tauben selber genügend Nahrung finden und nicht gefüttert werden sollen.
Auch über die Verbreitung von Krankheiten sowie die Stadtverschmutzung erhofft man sich Aufschlüsse.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
































Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch