
Bilaterale Schweiz–EU: Schlichtungsstelle fehlt

Bei den bilateralen Abkommen Schweiz-EU fehlt eine dritte Instanz als Schlichtungs-Stelle: Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie aus Bern und Brüssel.
Die bilateralen Abkommen funktionierten sonst aber gut, auch weil die Kompromiss-Lösungen meist eher zu Gunsten der EU ausfielen, befinden die Autoren.
Autoren der Studie sind Marius Vahl vom Zentrum für Politikstudien (CEPS) in Brüssel und Nina Grolimund vom Europa-Institut der Universität Zürich.
Dass eine dritte Instanz als Schiedsgericht fehle, sei ein «generelles Problem» bei den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, sagte Marius Vahl vom CEPS gegenüber der Nachrichtenagentur sda.
Immer wieder waren Vahl und Nina Grolimund bei ihren über 20 Experten-Befragungen, welche eine der Grundlagen der Studie bilden, auf unterschiedliche Interpretationen der exakten Abgrenzung der einzelnen Abkommen gestossen.
Keine Prognose bezüglich Steuerpolitik
Zum aktuellen Streitfall zwischen Bern und Brüssel, zur EU-Vereinbarkeit bestimmter kantonaler Praktiken bei der Unternehmensbesteuerung mit dem 1972 abgeschlossenen Freihandels-Abkommen, äussert sich die Untersuchung nur am Rand.
Ob sich dieser Streitfall zu einem grösseren Problem entwickeln werde, wollte Vahl nicht prognostizieren.
Allgemein lasse sich sagen, dass Bern und Brüssel pragmatisch nach Lösungen suchten, ergänzte der norwegische Wissenschafter.
Kompromiss oft näher an EU-Position
Dabei liege der schliesslich gefundene Kompromiss jeweils näher bei der EU-Position als bei derjenigen, welche die Schweiz ursprünglich eingenommen habe.
Bei der Entwicklung von EU-Recht spielt die Schweiz «eine vernachlässigbare Rolle», heisst es in der Studie. Das sei auch in der frühen Phase der Schengen-Gesetzgebung nicht anders.
Darüber, ob ein neues Politikfeld Schengen-relevant werde oder nicht, entscheide im Streitfall das oberste EU-Gericht, der Europäische Gerichtshof (EuGH).
Flughafenstreit mit Deutschland als «Testfall»
Auch der Flughafenstreit mit Deutschland ist derzeit beim EuGH hängig. Das Verfahren «ist ein wichtiger ‹Testfall› für die Rolle des Europäischen Gerichtshofes als neutrale Instanz», schreiben die Autoren.
Dauerhafte Ausnahmen hat die Schweiz bei der Weiterentwicklung von Schengen im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis erstritten.
Schweiz mit permanentem Ausnahmestatus
Beim europapolitischen Bericht, den der Bundesrat (Regierung) diesen Sommer präsentieren will, ist eine mögliche Option ein EU-Beitritt mit permanenten Ausnahmen.
Die Studie kommt jedoch zum Schluss, dass die EU seit der Erweiterung 2004 zunehmend heterogen geworden sei.
Das mache es für die EU schwieriger, flexibel zu sein und spezielle Ausnahmen einem Nicht-Mitgliedstaat zuzugestehen.
swissinfo und Agenturen
1972 wurde das Freihandels-Abkommen Schweiz/EWG für Industrieprodukte abgeschlossen.
1992 lehnte das Stimmvolk den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR ab.
1999 schlossen die Schweiz und die EU sieben bilaterale Abkommen, unter anderem im Bereich Personen-Freizügigkeit. Diese traten 2002 in Kraft.
Im Oktober 2004 wurde ein 2. Paket unterzeichnet, unter anderem Schengen/Dublin und Zinsbesteuerung.
Gegen Schengen/Dublin wurde das Referendum ergriffen. Im Juni 2005 wurde die Vorlage vom Volk dann jedoch klar angenommen.
Auch die Ausdehnung der Personen-Freizügigkeit auf die 10 neuen EU-Staaten wurde nach einem Referendum im September 2005 vom Volk angenommen.
Neue weitere bilaterale Verhandlungen werden geprüft, zum Beispiel im Elektrizitäts- oder Gesundheitsbereich.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


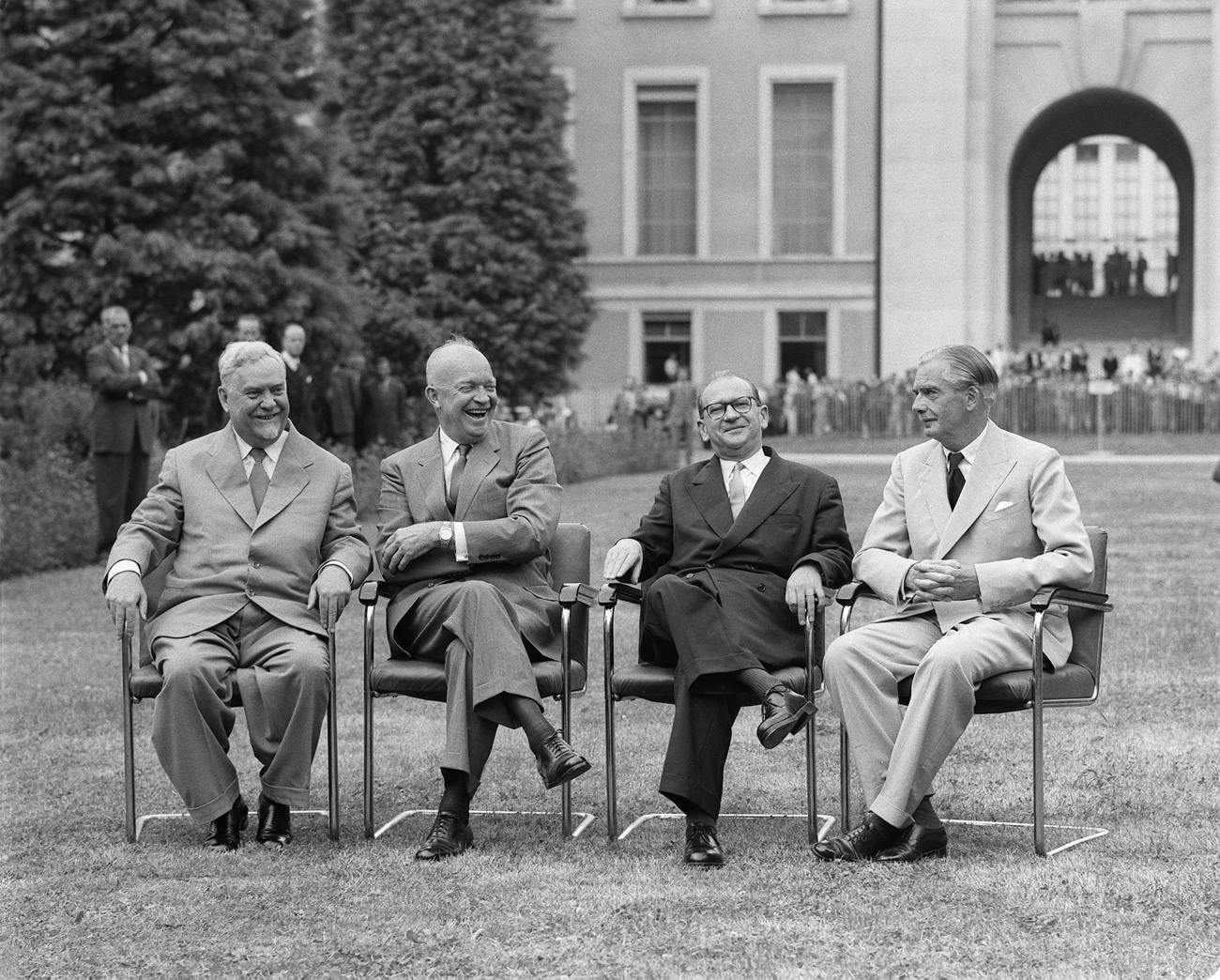
































Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch