
Der Zusammenbruch der schwedischen Armee

Braucht die Schweiz in einem nunmehr friedlichen Europa noch eine militärische Verteidigung, fragt sich der Westschweizer Autor Bertil Galland. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund der drastischen Massnahmen, mit denen Schweden die Armee umgestaltet hat.
Kaum ein Tag vergeht, ohne dass in der Presse vergleichende Tabellen veröffentlicht werden, in denen die europäischen Länder nach ihren finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen oder militärischen Stärken klassiert werden. Die Schweiz, die weder Mitglied der EU noch der NATO ist, fehlt jeweils auf diesen Listen.
Schlimmer ist jedoch die Absenz unserer Vertreter bei wichtigen Treffen. Unsere Botschafter sehen sich gezwungen, im Nachhinein Informationen über die Arbeit gewisser Expertengruppen einzuholen. Dieses Jahr wurden zum Beispiel im Sicherheitsbereich die mittel- bis langfristigen Risiken von Konflikten, Angriffen aus dem Cyberspace, Terroranschlägen oder offenen Kriegen auf unserem Kontinent diskutiert und evaluiert.
In Tat und Wahrheit existiert zum jetzigen Zeitpunkt keine eigene europäische Verteidigungspolitik. Die NATO ist vollständig vom Willen der USA abhängig. In Russland wirken moralische und materielle Kräfte, die Begehrlichkeiten nach Rückeroberungen wecken. Brennpunkte im Mittleren Osten grenzen an die Türkei, die einige gerne in der EU sähen.
Was macht die Schweiz?
Die Nationen Europas versuchen eine gemeinsame Strategie auszuarbeiten. Was macht die abseits stehende Schweiz? Eine wundersame Übereinkunft beruhigt die öffentliche Meinung. Unsere Nachbarn, zur Zeit 27 Länder, haben sich verpflichtet, in Tat und Recht auf jeden bewaffneten Konflikt untereinander zu verzichten.
Brauchen wir angesichts dieses nie dagewesenen Friedens überhaupt noch eine militärische Verteidigung? Reicht nicht eine gut ausgebildete Polizei? Diese Frage stellte Pierre Nidegger, Freiburger Polizeichef. Die Schweizer Behörden wollen Klarheit schaffen über den Alleingang der nationalen Verteidigung. Bundesrat Maurer hat die neueste Version des sicherheitspolitischen Berichts genauestens ausgearbeitet und zusammen mit einem Bericht zur Armee den beiden Kammern vorgelegt.
Es ist merkwürdig, dass zum Zeitpunkt dieser offiziellen Debatte die öffentliche Meinung südlich der Ostsee die drastischen Massnahmen nicht zur Kenntnis nimmt, die Schweden, neutral wie die Schweiz, ergriffen hat. Was ist dort geschehen? Die schwedische Armee ist zusammengebrochen – nichts weniger als das!
Die obligatorische Wehrpflicht wurde aufgehoben. Der Staat zahlt noch den Sold von rund 10‘000 Offizieren, Soldaten und Spezialisten. Seit 2000 haben sie den Auftrag, im riesigen Land die zwölf militärischen Distrikte mit allen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen aufzuheben. Die dazugehörigen Divisionen wurden aufgelöst. Es ist eine riesige Aufgabe für das Militär, das Sammelsurium von Ausrüstungen, Waffen, Reserven, Gebäuden und Grundstücken ihrer Einheiten zu verkaufen.
Schweden erlebte den Zusammenbruch der nationalen Armee weder mit Fanfaren noch mit Paukenschlägen, sondern eher wie ein Dominospiel – die Armee zerfiel, Stein für Stein.
Die Inspiration kam aus den USA
Weder früher noch später gab es ein ähnliches Vorgehen wie diese konfuse Auflösung. Sie war stark geprägt von den Ereignissen in der UdSSR. Zudem spielte der Golfkrieg 1991 eine Rolle, in dessen Folge sich die USA entschied, auf Nuklearwaffen zu verzichten. Statt verlustreiche Bodenkämpfe zu führen, hiess es nun, den feindlichen Luftraum zu beherrschen und das eigene Territorium mit Spitzentechnologie zu schützen. Feindliche Verbände und ihre Kommandoposten werden früh mit ferngesteuerten Waffen angegriffen.
Die Abschaffung der traditionellen Armee Schwedens ging keineswegs von den Pazifisten aus, sondern wurde von Offizieren empfohlen, die den USA nahe standen. Luftwaffengeneral Owe Wiktorin, seit 1994 Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, attackierte mit seinem Sparprogramm zuerst die Bodentruppen. Das Ende des Kalten Krieges nährte den Optimismus und politische Parteien von links bis rechts kamen überein, die militärischen Ausgaben zu beschneiden. Die Reduzierung des Staatsdefizits hatte oberste Priorität.
Was bleibt nun Schweden für die Verteidigung gegen äussere Bedrohungen? Die Armee gibt es nicht mehr, doch es gibt noch die Amtsstellen. Sie arbeiten an Konzepten – zum Beispiel die Integration der Zivilbevölkerung in die Sicherheitspolitik. Die materiellen Mittel sind verschwunden. Es gibt kein Übungsgelände mehr und keine Manöver. Protestbewegungen sind keine auszumachen.
Eine gewisse Unsicherheit macht sich heute doch bemerkbar. Sie kommt klar zum Ausdruck im kürzlich erschienen Werk Fredens Illusioner (Illusion des Friedens) von Wilhelm Agrell, Geschichtsprofessor aus Lund und profunder Kenner der schwedischen und internationalen Szene.
Der Autor unterstreicht, dass die bitteren Erfahrungen der USA im Irak und in Afghanistan zu einer Ablösung der asymmetrischen Kriegführung durch die Theorie des Krieges mit ferngesteuerten Waffen geführt haben. Das Lager der schwedischen Optimisten begrüsste mit Putin die Rückkehr eines starken Machthabers. Seine resolute Modernisierung der verlotterten Armee wurde wie ein Versprechen angesehen, das neue Russland an den technischen und wirtschaftlichen Veränderungen des grossen Europas zu beteiligen. Der Blitzkrieg von Georgien wirkte wie eine kalte Dusche.
Die Neugier zieht immer wieder Schweizer Autoren in die weite Welt hinaus.
Mit leichter Feder bringen sie uns Fremdes näher.
swissinfo.ch hat bekannte und weniger bekannte Autorinnen und Autoren eingeladen, über ihre Beobachtungen in der Wahlheimat zu berichten.
Bertil Galland wurde 1931 in Leysin (Waadt) geboren, sein Vater war Waadtländer, seine Mutter Schwedin.
Nach einem Studium der Geistes- und Sozialwissenschaften bildete er sich zum Journalisten weiter.
Auch als Herausgeber und Verleger machte er sich einen Namen. Von 1953 bis 1971 gab er die «Cahiers de la renaissance vaudoise» heraus und gründete 1971 seinen eigenen Verlag.
Neben seiner vielseitigen Tätigkeit übersetzte er auch skandinavische Werke ins Französische und gründete die Buchreihe CH, um der französisch sprechenden Leserschaft Deutschschweizer und Tessiner Autoren näher zu bringen.
Als Journalist gehörte er 1999 zu den Gründern des «Nouveau Quotidien».
Bertil Galland pendelt heute zwischen seinen zwei Wohnorten Lausanne und Richmont (Burgund).

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


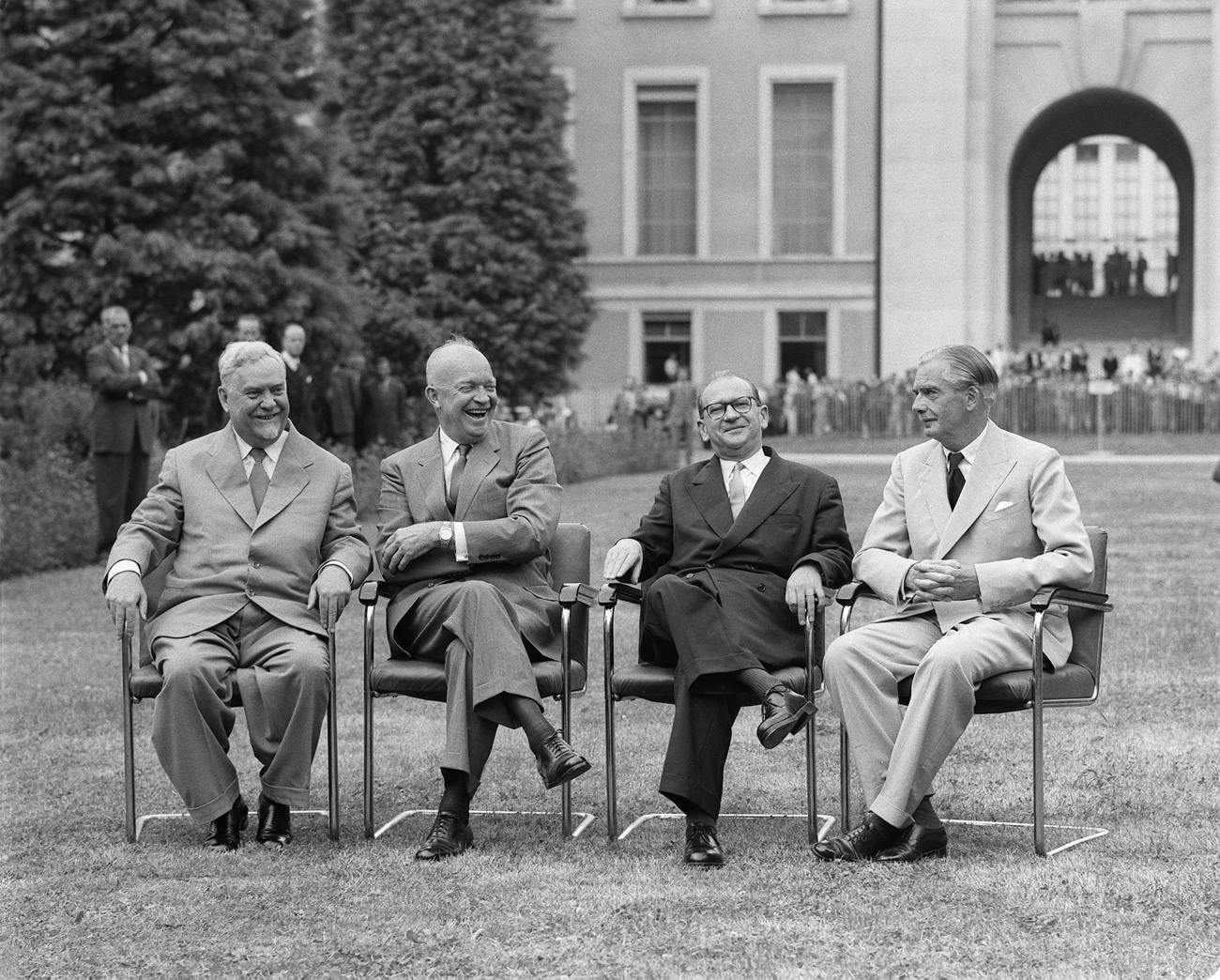






























Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch