
So steht der österreichische Ad-hoc-Kanzler zur Schweiz

Alexander Schallenberg hat seit seiner Kindheit eine enge Bindung zur Schweiz. Als neuer österreichischer Kanzler plädiert er in der zerfahrenen Situation mit der EU für Pragmatismus.
Der «geborene Diplomat», so wurde Alexander Schallenberg (52) schon oft bezeichnet. Tatsächlich wurde der neue österreichische Bundeskanzler gewissermassen in die Diplomatie hinein geboren: Er kam im Juni 1969 in Bern zur Welt, wo sein Vater als Diplomat arbeitete.
Seine ersten Lebensjahre verbrachte Schallenberg in der Schweiz, bis sein Vater nach Indien, Spanien und später Frankreich berufen wurde. Alexander Schallenberg wuchs mehrsprachig auf, und das Leben in verschiedenen Kulturen prägte ihn. Seine Verbindung in die Schweiz blieb aber wesentlich tiefgehender als die zu den anderen Ländern seiner Kindheit, da seine Mutter Schweizerin ist – aus einer nicht eben unbekannten Familie. Sein Grossvater Alfred Schäfer war einst Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bankgesellschaft.
An seine frühe Berner Zeit erinnere er sich nicht mehr, sagt Alexander Schallenberg bei einem Treffen mit swissinfo.ch. Aber später, als sein Vater nicht mehr in der Schweiz tätig war, habe er den Sommer immer in Lugano oder Zürich bei den Grosseltern verbracht. «Es waren besondere Momente, und deshalb habe ich eine besondere Beziehung zur Schweiz.“
Die abtrünnige Schweiz
Der Abbruch der Verhandlungen mit der EU im Mai 2021 durch die Schweizer Regierung und der «Schwebezustand» der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU seither sind für den überzeugten Europäer Schallenberg bedauerlich. Wird er – wie sein Vorgänger Sebastian Kurz – für die Schweiz Stellung beziehen?
«Natürlich, das ist etwas, das in unserem eigenen Interesse ist», sagt Schallenberg. «Die Schweiz liegt mitten im EU- Binnenmarkt, und ich glaube, wenn jetzt auch einiges nicht funktioniert hat, müssen wir pragmatisch mit der Situation umgehen. Wir brauchen einander.» Die Schweiz sei ein wichtiger wirtschaftspolitischer Partner und ein wichtiger Partner in der Wissenschaft. «Daher haben wir auch Interesse, dass diese Beziehungen gut und reibungslos funktionieren.»
Dass die Schweiz mit der sogenannten Kohäsionsmilliarde einen Beitrag an die EU zahlt, der zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten in der erweiterten EU gedacht ist, sieht Schallenberg als eine Notwendigkeit an, da für die Schweiz gleichzeitig die Vorteile des freien Marktes existierten. In der EU setzt sich zunehmend diese Auffassung durch, die Teilnahme am EU-Binnenmarkt sei durch regelmässige Kohäsionszahlungen abzugelten, ein Punkt, den die Schweizer Politik anders sieht.
Den in der EU oft erhobene Vorwurf, die Schweiz sei eine «Rosinenpickerin» lässt Schallenberg aber nicht gelten. Er sieht die Referendumsabstimmung vom Dezember 1992, als sich die Schweiz gegen den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) entschied, als Weichenstellung. Und er betont, dass die Schweiz ihren Beitrag leiste und die Entscheidungen der Schweizer Bevölkerung akzeptiert werden müssten.
«Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass die Schweiz schon Anfang der Neunzigerjahre einen eigenen Weg eingeschlagen hat. Österreich gehört sicher zu jenen Staaten, die dafür starkes Verständnis haben», sagt Schallenberg. «Ich glaube wir müssen mit der Situation, wie sie jetzt ist, umgehen und schauen, dass die Schweiz und der EU-Binnenmarkt konfliktfrei funktionieren. Dass es da Knirschen im Gebälk gibt, das ist klar. Aber wir dürfen die grundsätzliche Ausrichtung, die grundsätzliche Partnerschaft nie in Frage stellen.»
Die Marionette von Kurz?
Schallenbergs Worten merkt man seine Vergangenheit in der Diplomatie immer an. Politiker zu werden war nie Teil seiner Lebensplanung, wie er sagt. Als der parteilose (aber der ÖVP nahestehende) Diplomat im Juni 2019 nach der Auflösung der österreichischen Regierung die Agenden des Aussenministers übernahm – es war damals eine Konsequenz des sogenannten Ibiza-Skandals –, sah er sich selbst nur als Übergangslösung.
Doch seine Erfahrungen als Pressesprecher der österreichischen Aussenminister (zuerst Ursula Plassnik, dann Michael Spindelegger) und später die Leitung der Stabsstelle für aussenpolitische Planung unter dem damaligen Aussenminister Alexander Kurz (2013) machten sich für ihn bezahlt. Er konnte als einziges Regierungsmitglied sein Ministeramt auch 2020 im neugewählten Kabinett von Sebastian Kurz behalten.
Als Kurz im Oktober 2021 wegen Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler zurücktreten musste, bot ihm dieser sein Amt an. Schallenberg verteidigte Kurz in seinen ersten offiziellen Reden vehement als Opfer politischer Intrigen. Kurz blieb Chef der ÖVP und auch deren Fraktionsvorsitzender. Die Opposition warf Schallenberg deshalb vor, er sei eine «Marionette». Und der internationalen Presse machte der Begriff von Kurz als «Schattenkanzler» die Runde.
Schallenberg versteht diese Aufregung nicht. «Natürlich hat Sebastian Kurz das Amt des Parteiobmannes. Er wurde mit 99% gewählt und als Klubobmann wurde er mit 100% gewählt. Und natürlich arbeiten wir zusammen, ich habe es erstaunlich gefunden, dass diese Feststellung von mir zur Schnappatmung bei einigen Kommentatoren geführt hat.»
Lockdown für Ungeimpfte
Zurzeit hat Alexander Schallenberg andere Probleme. Die vierte Coronawelle hat Österreich fest im Griff, ein regionaler Lockdown zeichnet sich ab. Einen generellen Lockdown lehnt Schallenberg zwar ab, aber er schliesst einen Lockdown für Ungeimpfte in Österreich nicht aus.
Im Gegenteil, hier schlägt der neue Bundeskanzler dann auch weniger diplomatische Töne an: «Wir haben steigende Infektionsraten, wir haben eine massiv steigende Auslastung in den Intensivstationen. Da können wir nicht einfach tatenlos zusehen. Wir müssen die geschützten Menschen, die sich impfen liessen oder Antikörper haben, weil sie eben rekonvaleszent sind, unterstützen. Sie sollen Freiheiten haben gegenüber den Ungeimpften – den Zauderern und Zögerern.»

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


































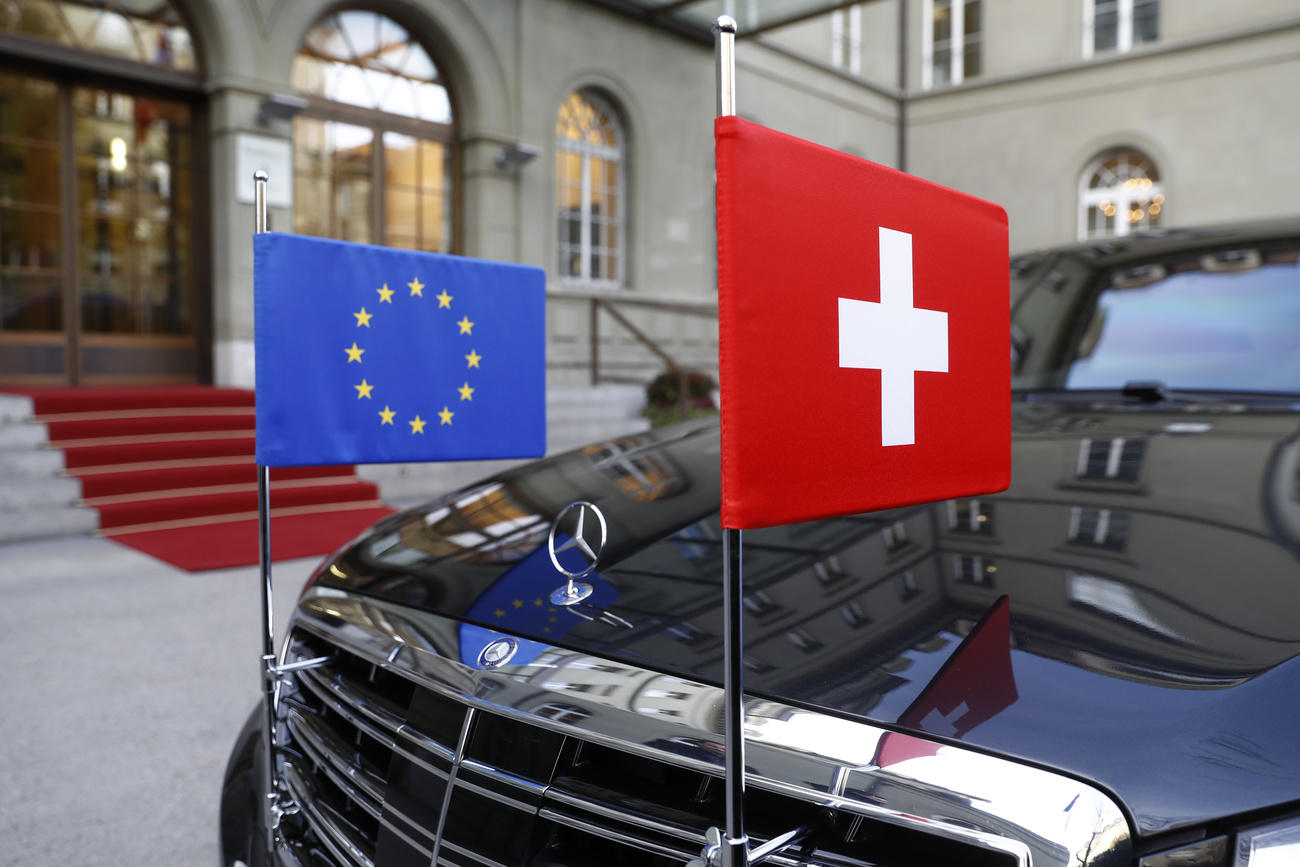
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch