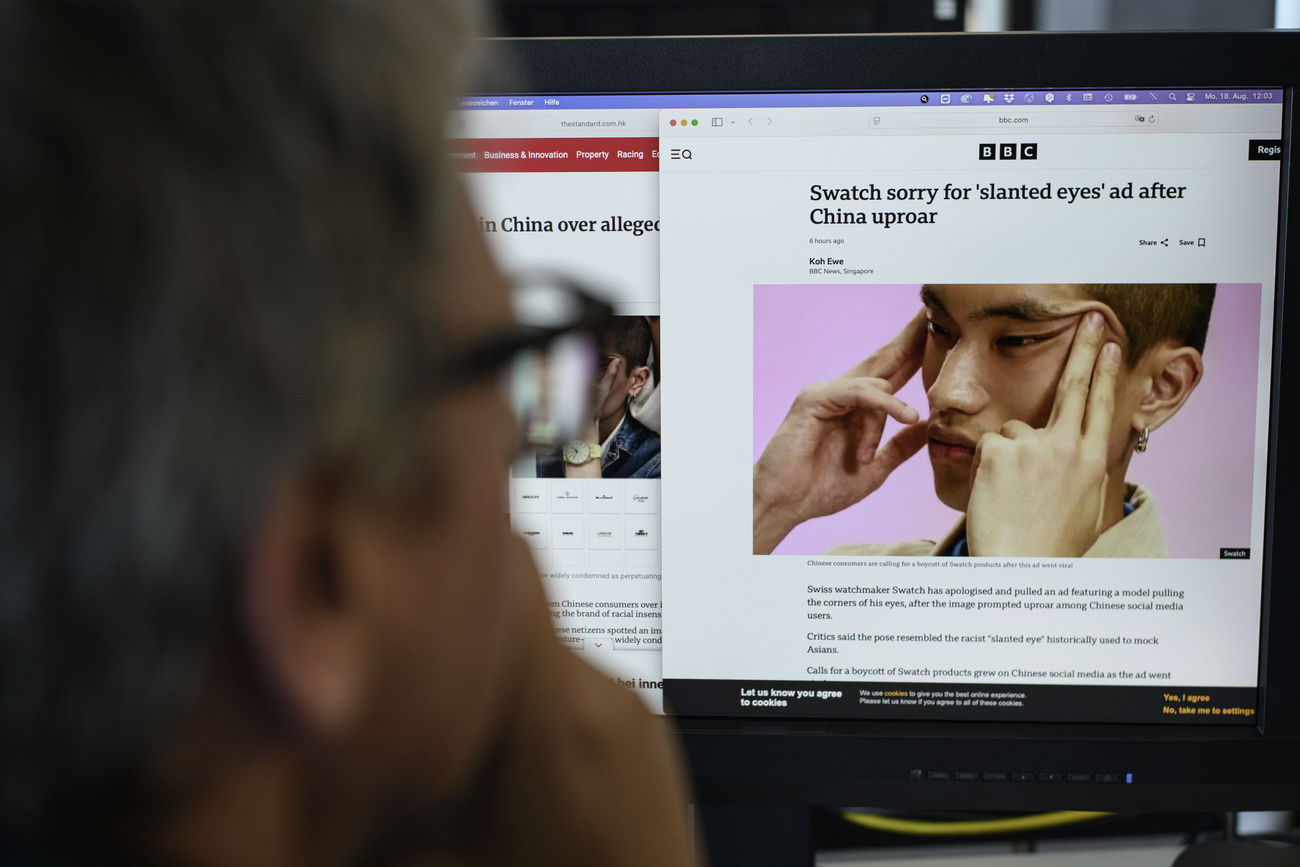Kanton Bern budgetiert Überschuss und will Steuern weiter senken

Die Berner Kantonsregierung rechnet 2026 mit einem Überschuss von 365 Millionen Franken. Die Schulden will Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) trotz weiterhin hoher Investitionen um 10 Millionen Franken reduzieren, wie sie am Freitag vor den Medien bekanntgab.
(Keystone-SDA) Im Budgetjahr rechnet der Kanton Bern mit Einnahmen von 14 Milliarden und Ausgaben von 13,67 Milliarden Franken. Letztere haben im Vergleich zur bisherigen Planung stark zugenommen, insbesondere im Bereich der Bildung. Die Regierung hofft diese jedoch mit höheren Steuererträgen und Zahlungen aus dem nationalen Finanzausgleich zu kompensieren.
Auch in den darauffolgenden drei Jahren rechnet der Kanton dank dieser Aussicht mit Ertragsüberschüssen von jeweils rund 300 bis 350 Millionen Franken. Regierungsrätin Astrid Bärtschi sprach denn auch von einem positiven Planungsresultat. Es ermögliche einen Teuerungsausgleich und individuelle Gehaltsanpassungen für die Kantonsangestellten sowie weitere Steuerentlastungen für die Bernerinnen und Berner.
Steuersenkungen ab 2027
Entsprechend sieht sich der Kanton bei seiner Steuerstrategie auf Kurs. Er plant bis und mit 2029 Steuerentlastungen von insgesamt rund 440 Millionen Franken. Dies will er unter anderem mit einer geplanten Steuerrevision erreichen, die eine Glättung der Progression zum Ziel hat. Insbesondere Personen mit tieferen bis mittleren Einkommen sollen davon profitieren.
Der Grosse Rat wird im Herbst zum ersten Mal darüber debattieren, in Kraft treten soll die Revision 2027. «Sie kann nicht schnell genug kommen», sagte Bärtschi am Freitag. Ebenfalls ab 2027 soll die Steueranlage für natürliche Personen gesenkt werden, ab 2029 jene für juristische Personen.
SNB birgt Risiko
Die Steuereinnahmen bergen jedoch auch das Risiko, tiefer als budgetiert auszufallen. Gleiches gilt für die Zahlung aus dem nationalen Finanzausgleich. Weiter schätzt der Kanton das Sparprogramm des Bundes sowie die angespannte finanzielle Lage des Berner Spital- und Psychiatriebereichs als Risiko ein. Im Budget seien aber keine spezifischen Beträge für weitere Rettungsschirme eingestellt.
Unsicherheit besteht auch im Zusammenhang mit den Gewinnausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Im Budgetjahr rechnet der Kanton – wie bereits 2025 – nicht mit einer Gewinnausschüttung. In den Jahren darauf ist diese aber wieder im Budget enthalten, weil eine neue Vereinbarung zwischen SNB und Bund in Kraft treten soll.
Fällt die Ausschüttung jedoch weg, hätte der Kanton Bern um jährlich 160 Millionen Franken daneben budgetiert. Unter anderem deshalb geht Bärtschi insbesondere ab 2027 von einem erhöhten Risiko aus. Ab diesem Zeitpunkt sieht der Kanton zudem «keine weiteren Anstrengungen vor, um den Rückstand auf die Teuerung aufzuholen».
Investitionen weiterhin hoch
Neben dem Risiko dürfte auch die Verschuldung ab 2027 weiter zunehmen. Aktuell kann der Kanton nämlich noch auf seine Fonds zurückgreifen, wie Beat Zimmermann, Leiter der Finanzplanung, ausführte. Das Budget sieht Auflösungen in der Höhe von rund einer Viertelmilliarde Franken vor. Danach seien diese voraussichtlich weitgehend aufgebraucht, was gemäss Zimmermann 2027 in einer Neuverschuldung von 42 Millionen Franken resultieren dürfte.
Wie in den Vorjahren erfordern Hochbauprojekte im nächsten Aufgaben- und Finanzplan hohe Investitionen, etwa für die beiden Fachhochschulen in Bern und Biel oder das Polizeizentrum in Niederwangen. Im Budget 2026 sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 706 Millionen Franken vorgesehen.
Eine «einschneidende» Priorisierung der Projekte wie im Vorjahr ist nicht vorgesehen. Damals entschied der Grosse Rat im Rahmen der Budgetdebatte etwa, auf die Technische Fachschule in Burgdorf zu verzichten. Trotzdem: «Auch in Zukunft ist eine vorsichtige Finanzpolitik angezeigt», bilanzierte Bärtschi.
Moutier verursacht Minus
Der geplante Kantonswechsel der Stadt Moutier per 2026 in den Jura hat voraussichtlich negative Auswirkungen auf die Berner Finanzen. Bärtschi rechnet mit einer Verschlechterung von jährlich rund 12 Millionen Franken, etwa aufgrund von Mindererträgen bei den Steuern. Im Gesundheitswesen und der Volksschule stehen wiederum weniger Kosten an.