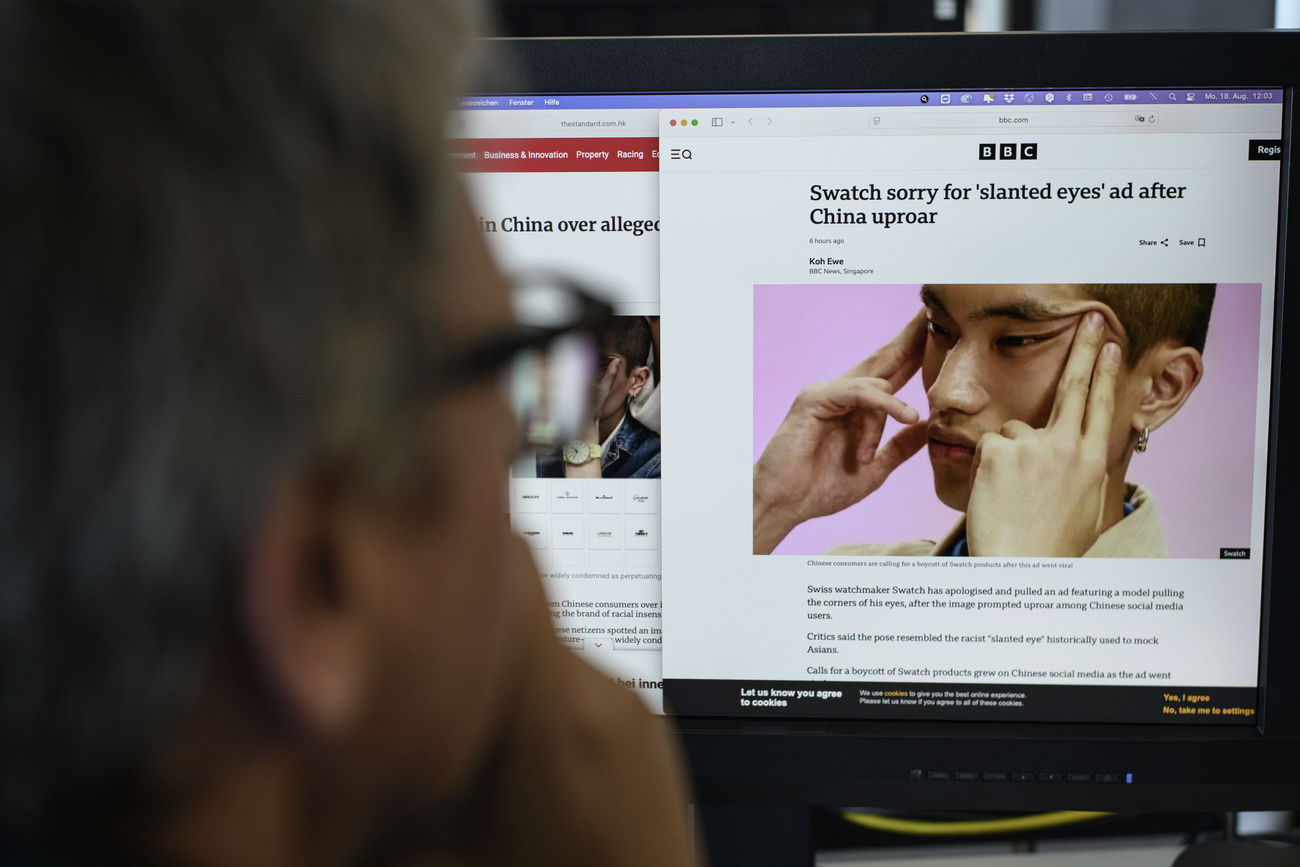Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Während in Lausanne nach dem Tod eines jungen Mannes, der auf einem Roller vor der Polizei flüchtete, erneut Unruhen ausgebrochen sind, bringen zwei weitere Vorfälle die Ordnungskräfte in eine sehr unangenehme Lage.
Herzliche Grüsse aus Bern

Während Lausanne eine zweite Nacht der Unruhen erlebte, nachdem am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann bei der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen war, könnten neue Enthüllungen die Lage weiter verschärfen. Dabei geht es um den Austausch rassistischer, antisemitischer und sexistischer Nachrichten zwischen Mitgliedern der Lausanner Polizei.
Die Stadtverwaltung von Lausanne hat die Existenz von Nachrichten oder Fotos mit rassistischen, antisemitischen, sexistischen oder diskriminierenden Inhalten aufgedeckt, die zwischen Polizisten oder ehemaligen Polizisten ausgetauscht wurden. Vier von ihnen wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert.
Die vollzählig vor der Presse versammelte Lausanner Exekutive zeigte am Montag einige dieser Nachrichten. Ein Aktionsplan wurde beschlossen. Dieser beinhaltet «Sanktionen gegen die identifizierten Täter, zusätzliche Untersuchungsmassnahmen und eine tiefgreifende Reform der Arbeitskultur innerhalb der Stadtpolizei».
Die Waadtländer Polizei steht auch in einem anderen Fall unter Druck. Ein neuer Bericht stellt die Notwehr in Frage, auf die sich jener Polizist berief, der 2021 am Bahnhof Morges auf Roger «Nzoy» Wilhelm geschossen und ihn dabei getötet hatte.
2D- und 3D-Bilder und -Analysen haben ergeben, dass Nzoy zu fliehen versuchte. «Wenn Nzoy geflohen ist, liegt keine Notwehr vor», sagte der Anwalt der Familie von Nzoy. Nachdem die Untersuchung der Staatsanwaltschaft eingestellt worden war, wurde sie im Mai vom Waadtländer Kantonsgericht wieder aufgenommen und es wird zu einem Prozess kommen.

Fast zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung wünschen sich mehr Freiheit bei der Wahl des Rentenalters. Die bisher vorgeschlagenen AHV-Reformen, insbesondere die Erhöhung der Beiträge, sind wenig populär. Dies geht aus einer am Dienstag vorgestellten Studie des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte hervor.
Die Bevölkerung «strebt eher nach mehr Freiheit als nach starren Altersgrenzen» und erwartet «Reformen, die wirtschaftlich sinnvoll sind und in Richtung Generationengerechtigkeit gehen», sagt Reto Savoia, CEO von Deloitte Schweiz.
Die Studie schlägt daher vor, dass Rentenalter flexibler zu gestalten. In Zukunft sollte jede Person selbst entscheiden können, wann sie in den Ruhestand geht, basierend auf Kriterien wie Gesundheitszustand, finanzielle Situation und individuelle Lebenspläne.
Eine relative Mehrheit der Befragten (44%) befürwortet die Idee einer Erhöhung der Bundesbeiträge zur AHV. Während eine Erhöhung der Lohnbeiträge mit 49% Ablehnung umstritten bleibt, stösst eine Erhöhung der Mehrwertsteuer (65% dagegen) bereits auf deutliche Skepsis. Eine Kürzung der Renten lehnen sogar mehr als drei Viertel der Befragten ab.

Der Bundesrat hat laut den Zeitungen von CH Media die UBS um Hilfe im Zollstreit mit den USA gebeten. Diese Vermittlerrolle könnte es der Grossbank ermöglichen, ihre Beziehungen zu Karin Keller-Sutter zu verbessern.
Die Anfrage soll direkt vom Wirtschaftsdepartement unter Guy Parmelin sowie aus Wirtschaftskreisen gekommen sein. In den USA ist die UBS ein wichtiger Arbeitgeber. Zudem sollen CEO Sergio Ermotti und Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher über ein gutes Netzwerk in New York und Washington verfügen.
Laut Recherchen von CH Media haben bereits erste Kontakte der UBS mit den US-Behörden stattgefunden. «Die Lobbyarbeit für die Schweiz läuft», heisst es in Finanzkreisen.
Laut denselben Kreisen hofft die Grossbank, aus ihren Guten Diensten einen positiven Nebeneffekt zu ziehen. Denn als Finanzministerin spielte Karin Keller-Sutter eine führende Rolle bei der Ausarbeitung der neuen Eigenkapitalvorschriften für die UBS, die diese dazu zwingen, zusätzliches Kapital in Höhe von 25 Milliarden Franken zu beschaffen.

Aufgrund des Aufkommens von generativer Künstlicher Intelligenz müssen Studierende der juristischen Fakultät der Universität Zürich ab 2026 ihre Doktorarbeit mündlich verteidigen.
ChatGPT ist inzwischen Teil des Uni-Alltags geworden. Die Verwendung des KI-Tools beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten wirft jedoch viele Fragen auf. Mehrere Zürcher Universitäten und Hochschulen arbeiten an Richtlinien für die Verwendung von KI oder haben diese bereits formuliert, wie der Tages-Anzeiger berichtet.
An der Pädagogischen Hochschule Zürich ist die Zahl der abgelehnten Arbeiten in den letzten Jahren leicht gestiegen. Auch an der Universität Zürich (UZH) gab es Fälle, in denen KI verwendet wurde, ohne dass dies korrekt deklariert wurde. Die Universität erhebt jedoch keine konkreten Zahlen.
Ab 2026 wird die juristische Fakultät der UZH daher das Prüfungsverfahren für Dissertationen ändern. «Eine mündliche Abschlussprüfung gehört inzwischen zu den internationalen Standards und ermöglicht es auch, Missbrauch von KI aufzudecken», sagt Dekan Thomas Gächter.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards