
Kathedralen der Wasserkraft

Wasserkraftwerke prägen das helvetische Landschaftsbild. Ihre Architektur spiegelt ein Stück Schweizer Industrie- und Entwicklungsgeschichte.
Ein Bildband des Fotografen Alessandro Botteri Balli zeigt die aussergewöhnlichsten Bauwerke der Wasserkraft.
Die Wasserkraft gehört zur Alpenrepublik wie Banken, Käse oder Schokolade. Ob an Flussläufen im Flachland, ob in Bergtälern oder auf Passhöhen: Ihre Präsenz ist allgegenwärtig. Hunderte von Wasserkraftwerken zählt die Eidgenossenschaft.
Der Bau der hydroelektrischen Anlagen ist Bestandteil eines Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesses, der um 1900 begann. Die Erzeugung der elektrischen Energie mittels Turbinen und Generatoren sowie ihr Transport über weite Strecken veränderte nicht nur das Leben der Einzelnen, sondern auch das Siedlungsgefüge der Schweiz.
Das Kraftwerk Thorenberg (1886) gilt als ältestes schweizerisches Wechselstromkraftwerk, wie Michael Widrig in seinem begleitenden Essay zur Architektur der Wasserkraftwerke schreibt. Er unterteilt die Baugeschichte zugleich in verschiedene Phasen, die den jeweiligen Zeitgeist und die Einstellung zur Technik spiegeln.
Von Palästen und Kathedralen…
Die Pionierbauten – wie Thorenberg – waren demnach noch reine Zweckbauten ohne repräsentative Ansprüche. Dies änderte sich mit den ersten Grossanlagen im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Technischer Fortschritt wurde nun selbstbewusst als Sieg über die Natur zur Schau gestellt.
Die menschenleeren und lichtdurchfluteten Turbinenhallen spiegeln Sauberkeit, Sicherheit, Hygiene und Bequemlichkeit. Wie klassizistische Paläste erheben sich einige, damals konzipierte Kraftwerke, beispielsweise das Rhonekraftwerk «La Coulouvrenière» (1886) in Genf oder das Flusskraftwerk Rheinfelden (1898). Sie symbolisieren Macht und Dauerhaftigkeit.
Ab 1905 standen einige Gebäude unter dem Einfluss der Heimatschutzbewegung, bevor sich die Kraftwerksarchitektur ab den 20er Jahren an einer neuen Sachlichkeit orientierte. Dies bedeutete einen Verzicht auf Schnörkeleien. Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wie die Zentrale von Siebnen (1926), die wie eine neugotische Kathedrale daher kommt.
…bis zu verborgenen Zentralen
In der Nachkriegszeit setzte sich dann eine architektonische Einstellung durch, die Leichtigkeit und Eleganz zum Ziel hatte. Nicht mehr die Beherrschung der Natur, sondern der Dialog mit der Natur stand im Vordergrund, wie beispielsweise beim Flusskraftwerk Birsfelden (1955). Ein Teil der Anlage sieht aus wie eine Aneinanderreihung von Fischerhäuschen.
In den Kavernenzentralen der Berge wird diese Entwicklung ins Extrem getrieben. Zu sehen sind nur noch kleine und unscheinbare Eingänge, während die gigantischen Maschinenräume sich im Erdinnern befinden, unsichtbar für den aussenstehenden Beobachter. Ein gutes Beispiel ist das Maggia-Kraftwerk in Robiei (Tessin), welches das Buch-Cover ziert.
Wie Architekt Widrig in seinem Essay schreibt, sind die Kraftwerksbauten Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu vielen anderen industriellen Bauten blieben sie mehrheitlich vom Abriss und damit von einer «De-Industrialisierung» verschont. Dies erklärt ihre grosse architekturgeschichtliche Bedeutung.
Unsichtbares Wasser
Visuell aufgezeigt wird diese Entwicklung durch Fotografien an Hand von 50 Wasserkraftwerken, die nach ihren zugehörigen Flussgebieten Po, Donau, Rhein und Rhone gruppiert sind. Die langen Belichtungszeiten der schwarz-weiss-Bilder treibt den menschenleeren Kathedralen-Charakter vieler Maschinenhallen auf die Spitze.
Dabei berührt es manchmal merkwürdig, dass bei den Speicherkraftwerken das energieerzeugende Element, das Wasser, unsichtbar bleibt. Es ist in den Druckleitungen verborgen. Die Niederdruckkraftwerke erscheinen dagegen wie Brücken über Flüsse.
Der Bildband wird durch zwei kurze, aber prägnante Essays von Walter Hauenstein und Daniel Schafer zu Geschichte und Technik der Wasserkraft abgerundet. Da können wir erfahren, dass die gesamte Wasserkraftproduktion der Schweiz nur etwa 1,5 Prozent der Stromproduktion in den 15 EU-Staaten entspricht.
swissinfo, Gerhard Lob
Alessandro Botteri Balli, Wasserkraftwerke der Schweiz, Architektur und Technik, Offizin Verlag Zürich, 2003, Fr. 85.-
Erster Einsatz von Glühlampen: 1879 im Kulmhotel St. Moritz
Ältestes Wechselstromkraftwerk der Schweiz: Thorenberg (1886)
Grösstes Wasserkraftwerk: Grande Dixence SA (2000 MW)
Wasserkraftwerke in der Schweiz: 480 (Turbinenleistung von mehr als 300kW)
Anteil Wasserkraft am Stromverbrauch in der Schweiz: 60%
Anteil Wasserkraft am Total-Energiebedarf: 13%
Die elektrische Energie wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert zum Sinnbild der Aufbruchsstimmung.
Der Bau von hydroelektrischen Kraftwerken in der Schweiz spiegelt so einen Industrialisierungs- und Modernisierungsprozess, der in der Landschaft nachhaltige Spuren hinterlassen hat.
Ein Bildband des 1965 im Tessin geborenen Fotografen Alessandro Botteri Balli, der heute in Zürich und Mailand tätig ist, dokumentiert die Schweizer Wasserkraftwerke als Zeitzeugen des Fortschritts.
Der Band erlaubt nicht nur Aussenansichten von Gebäuden, sondern auch den Blick ins weniger bekannte Innenleben der Maschinenräume.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards














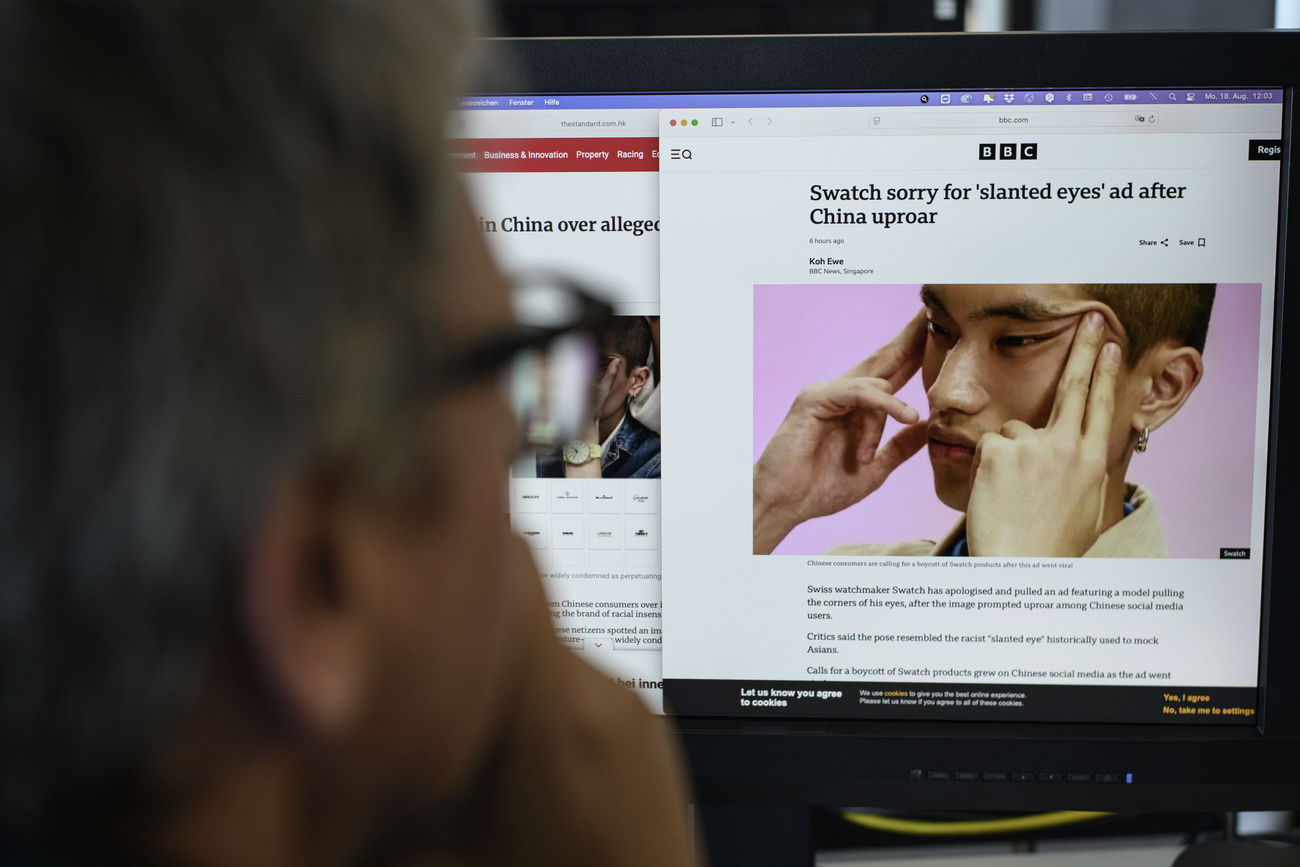

















Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch