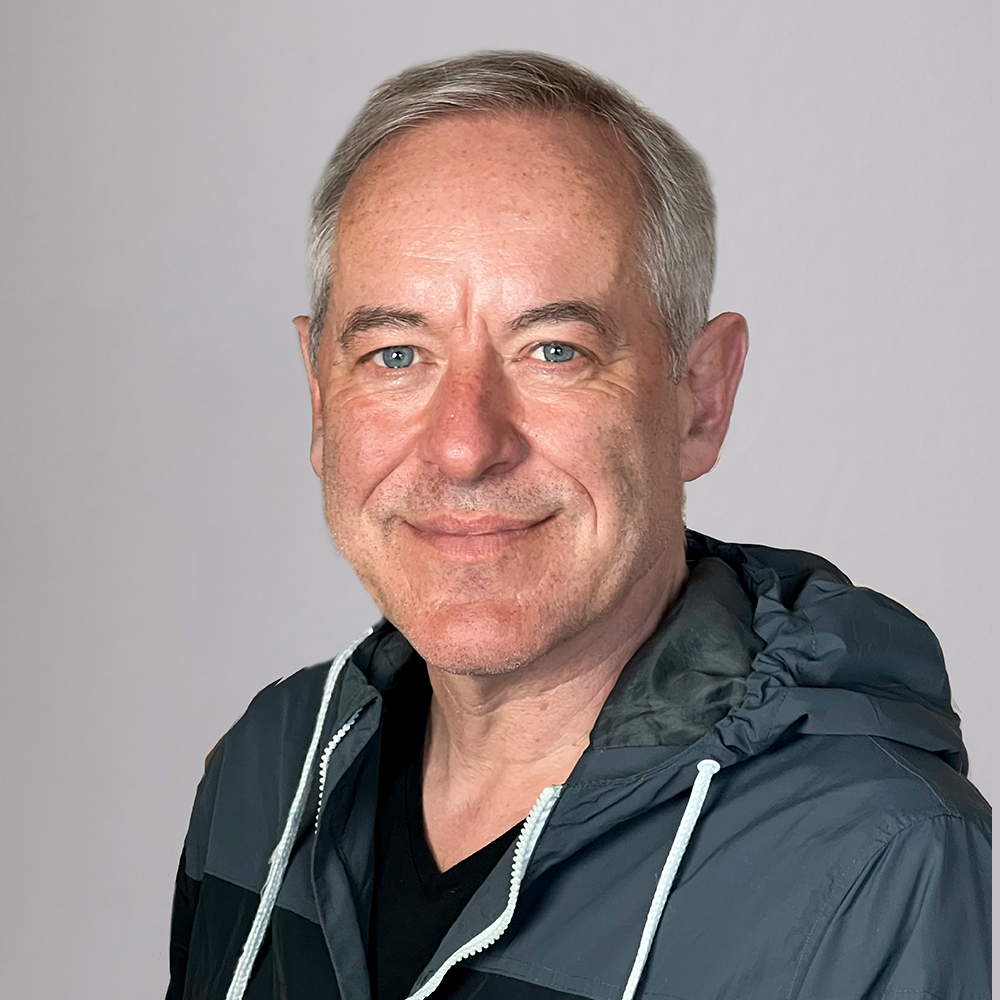Heute in der Schweiz
Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
Ein Schweizer pflügt in Brasilien die Landwirtschaft um – entschuldigen Sie das Wortspiel, aber die Geschichte von Ernst Götsch bedarf tatsächlich grosser Worte.
Freundliche Grüsse aus Bern

Ein ausgewanderter Agronom in Brasilien wird mit einer neuen landwirtschaftlichen Methode zum Phänomen.
Landwirt und Philosoph: So sieht sich Ernst Götsch. Und er ist definitiv auch ein Influencer, wenn auch ein unüblicher. Der Thurgauer wanderte 1982 nach Südamerika aus und mischte mit seiner «syntropischen Landwirtschaft» die Anbaumethoden des Riesenlandes auf.
Vereinfacht gesagt ist es ein Abschied von den Monokulturen, die in Brasilien – wie in den meisten Ländern – das Rückgrat der industriellen Landwirtschaft ausmachen. Die brauchen wir, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, sie belastet aber die Böden und entwickelt im Zusammenspiel mit dem Klimawandel bedenkliche Tendenzen.
Götsch zeigt, dass es auch anders geht. Seine Methode ahmt natürliche Prozesse nach und beschleunigt sie. Das klappt so gut, dass sogar Grossbauern darauf zurückgreifen – und er Pate stand für eine Doku-Soap.
- Lesen Sie hier unser Porträt.
- Gibt es irgendetwas in Bezug auf Lebensmittel oder Landwirtschaft, das Sie neugierig oder besorgt macht? Hier geht es zu unserer Debatte – machen Sie mit!

Die LGBTIQ-Gemeinde kriegt in Zürich bald ihr eigenes Grabfeld.
Der Friedhof Sihlfeld bietet ab Herbst das Grabfeld «Regenbogen» an, das sich an Mitglieder der Community der LGBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intersex und Queer) richtet. Es ist das erste seiner Art in der Schweiz, andere Länder haben ähnliche Möglichkeiten schon länger eingerichtet.
«Man möchte so ruhen, wie man gelebt hat», sagt eine Initiantin. Da queere Personen oft von der Gesellschaft oder selbst von ihren Familien nicht akzeptiert würden, sei man auf die queere Community angewiesen – diese Verbundenheit solle auch nach dem Leben sichtbar sein.
Die Stadt Zürich bietet verschiedene Themengräber an. Zum Beispiel ein Grabfeld für Menschen, die mit ihren Haustieren begraben werden wollen, oder das Themengrab «Rebstock», das in einem terrassierten Feld mit Magerwiese, geschnittenen Eibenhecken und Hängebirken steht. Die Parzelle für LGBIQ-Personen schliesst an die anderen Themengräber an.
- Hier finden Sie den Artikel meiner Kollegin Kaoru Uda.
- Wie steht es mit den Rechten der LGBTIQ in der Schweiz? Unser Fokus.
- Übrigens: Ab heute finden in Bern die Eurogames statt, der grösste LGBTIQ-Sportevent Europas – SRF berichtetExterner Link.

Die neue Autobahn-Vignette kommt – neu auch in digitaler Form.
Sie kennen es vermutlich: Jedes Jahr muss man mühsam die alte Vignette am Auto abkratzen – oder man klebt die neue daneben, büsst aber etwas Sichtfeld ein. Ab heuer gibt’s aber die Möglichkeit, gänzlich auf die Kleber zu verzichten.
Der Bund lanciert ab dem 1. August die E-Vignette. Man registriert sich online, die Vignette ist danach mit dem Nummernschild (und nicht dem Gefährt) verknüpft. Das soll vor allem Personen aus dem Ausland das Fahren einfacher machen. Auf sie entfallen immerhin ein Drittel der zehn Millionen Vignetten-Käufe.
Übrigens hat es fast zehn Jahre gedauert, bis die elektronische Form umgesetzt wurde. Die ersten Schritte wurden 2013 eingeleitet, nachdem die Preiserhöhung auf 100 Franken an der Urne abgelehnt wurde. Der Preis bleibt mit 40 Franken weiterhin derselbe, eine Abschaffung des Klebers ist vorerst nicht geplant.
- SRF News hat die wichtigsten Fragen & AntwortenExterner Link.
- Auch der Tages-Anzeiger berichtetExterner Link.

Wieso haben Kinder 13 Wochen Ferien, die Eltern aber nur fünf?
Manche haben neun Wochen Ferien, andere drei Monate – die Rede ist von den Sommerferien für die Schulen. In der Schweiz sind es weniger, aber immer noch genug, um Eltern (die üblicherweise auf fünf Wochen für das ganze Jahr kommen) vor Herausforderungen zu stellen.
Die NZZ ist der Frage nachgegangen, woher die Anzahl der Ferienwochen heute kommt. Bei den Angestellten ist das gut erforscht, bei den Schulferien allerdings nicht – sprich, niemand weiss genau, wieso Kinder heute ihre Schulferien so haben, wie sie die Schulbehörde geplant hat. Klar ist, dass es mit den landwirtschaftlichen Zyklen zu tun hat: Die Kinder sollten schulfrei haben, um auf dem Hof mit anpacken zu können – erinnert sich noch jemand an die «Heuferien»?
Ist das heute noch zeitgemäss? Die NZZ wirft die Frage auf, ob es nicht eine Flexibilisierung der Schulzeit brauche. In gewissen Privatschulen habe man bereits gute Erfahrungen damit gemacht. Die Idee klingt interessant – aber ob sie auch realistisch ist?
- Hier geht esExterner Link zum Artikel der NZZ. (Paywall)
Mehr

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards