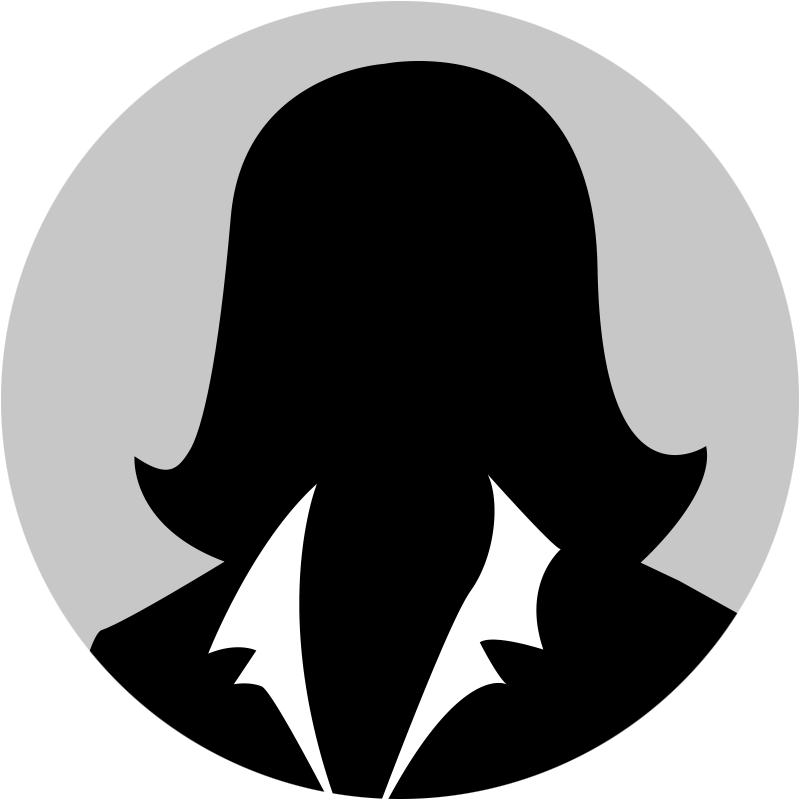Heute in der Schweiz
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
Die Schweiz hat im internationalen Vergleich sowieso schon eine der höchsten Lebenserwartungen. Nun zeigt eine Studie: Schweizerinnen und Schweizer möchten 93 Jahre alt werden.
Zudem: Erneuter Rüffel für die IT-Strategie der Bundesverwaltung, Lehrlinge der Gen Z lösen öfter ihren Lehrvertrag auf, und die Schweiz wird im Fall der Spitzenläuferin Caster Semenya verurteilt.
Herzliche Grüsse aus Bern

93 Jahre alt möchten Schweizerinnen und Schweizer werden, wenn sie wünschen könnten. Das zeigt eine repräsentative Studie. Dafür wären sie auch bereit, tiefer in die Tasche zu greifen.
Bei einer Befragung zum Verhältnis der Schweizer Bevölkerung zu den Krankenkassen wurde auch nach dem Wunschalter gefragt. Die Antworten der 1212 Befragten überraschten Studienleiter Marcel Thom: «Mit einem durchschnittlichen Wunschalter von rund 93 haben wir nicht gerechnet. Das ist schon sehr hoch», sagte er gegenüber SRF News. Die Studie führte das Beratungsunternehmen Deloitte durch.
In der Schweiz liegt die durchschnittliche Lebenserwartung laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) gegenwärtig bei 84 Jahren. Gegenwärtig ist ein regelrechter Boom in Sachen Langlebigkeit zu beobachten, so genannte Longevity-Kliniken schössen überall aus dem Boden, sagt Thom.
Das Ziel ist, gesund alt zu werden. Und dafür sind die Schweizerinnen und Schweizer laut der Studie auch bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. 60% der Befragten gaben an, sie würden maximal 150 Franken zahlen wollen, um möglichst gesund länger leben zu können, 40% würden mehr dafür ausgeben.

Seit Jahren sorgen Informatik-Projekte des Bundes für negative Schlagzeilen. Nun rügt die Finanzkontrolle die Bundesverwaltung deswegen erneut.
Laut SRF News hat die Eidgenössische Finanzkontrolle mehr als 80 eigene Untersuchungsberichte aus den letzten vier Jahren ausgewertet. Sie kam dabei zum Schluss, dass der Bund häufig Anwendungen beschaffe, ohne vorher den tatsächlichen Bedarf und den Nutzen sauber geklärt zu haben.
Brigitte Christ, stellvertretende Direktorin der Finanzkontrolle, sagte gegenüber SRF News, der digitale Bereich beim Bund sei zu kompliziert organisiert. Es würden unglaublich viele verschiedene Gremien mitreden.
Der IT-Bereich in der Bundesverwaltung müsse vereinfacht werden, so Christ: «Es ergibt keinen Sinn, wenn jedes Departement zehn eigene Portale betreibt; das bringt keinen Mehrwert. Ganz im Gegenteil: Der Anwender wird eher irritiert, dass er für jeden Behördenkontakt unter Umständen ein anderes Portal verwenden muss.»

«Jede fünfte Lernende löst ihren Lehrvertrag auf.» Diese Schlagzeile ist heute in den Publikationen der Tamedia-Gruppe zu lesen. Was steckt dahinter?
Laut den neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) lösten im Jahr 2023 22,4% der jungen Frauen in Ausbildung ihren Lehrvertrag auf. Diese Zahlen seien in den letzten Jahren stark angestiegen. Zwar liegt der Anteil bei den jungen Männern mit 25,8% höher, doch dieser blieb auf diesem Niveau stabil.
Betroffen davon ist grösstenteils die Generation Z. Gemäss einer aktuellen Studie des Zentrums Arbeit und psychische Gesundheit sollen 60% aller Jugendlichen in der Lehre unter psychischen Problemen leiden.
Allerdings bedeutet die Auflösung des Lehrvertrags nicht automatisch den Abbruch der Lehre, heisst es im Artikel. Als Auflösung gelte auch ein blosser Vertragswechsel, wenn zum Beispiel der Betrieb gewechselt oder die Dauer der Lehre verlängert werde. Insgesamt zeige sich: «Handwerkliche Berufe weisen tendenziell höhere Auflösungsquoten auf.»

Der Europäische Menschenrechts-Gerichtshof (EGMR) verurteilt die Schweiz im Fall von Caster Semenya. Sie habe die Menschenrechte der südafrikanischen Sportlerin verletzt.
Semenya wird als Person mit «Abweichungen in der sexuellen Entwicklung (DSD)» eingestuft. Sie gewann 2012 und 2016 Olympia-Gold über 800 Meter. Doch seit 2019 darf sie wegen der Testosteron-Regel nicht mehr bei internationalen Rennen über ihre Paradestrecke antreten. Sie hatte sich geweigert, ihren Testosteronspiegel zu senken.
Die Grosse Kammer des EGMR bestätigte heute ein Urteil von 2023. Dieses habe sich gegen die Schweiz gerichtet, weil das Bundesgericht in Lausanne als letzte nationale Instanz über den Fall entschieden hatte, schreibt SRF News. Semenya hatte den Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS), der seinen Sitz ebenfalls in Lausanne hat, an das höchste Schweizer Gericht weitergezogen.
Der Gerichtshof verurteilte die Schweiz nicht wegen dieses Urteils, sondern wegen der Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren, das heisst, wegen Verstössen gegen Semenyas Recht auf Privatsphäre. Welche Folgen das EGMR-Urteil für die Weltklasse-Athletin konkret hat, wird sich wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt zeigen.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards