
Warum die Schweizer Demokratie ein Vorbild für hochverschuldete Länder wie Japan sein könnte

Ein japanischer Finanzwissenschaftler hat dazu geforscht, warum die direktdemokratische Mitwirkung bei Finanzbudgets und Steuern in der Schweiz auch für Japan ein Ansatz sein könnte, um ausgeglichenere Budgets zu haben und das Vertrauen in die Politik zu stärken.
Viele Menschen treffen ihren Wahlentscheid wegen der Steuer- und Ausgabenpolitik. Auch der japanische Wahlkampf 2025 war von Finanzthemen geprägt: Mehrwertsteuer, kostenlose Schulbildung, höhere Verteidigungsausgaben. Viele Wähler:innen entschieden sich am 20. Juli wegen diesen Themen für eine Partei. Aber sie können nicht sicher sein, dass sich ihre Stimme auch in der japanischen Finanzpolitik niederschlägt.
Es ist ein Grundprinzip von öffentlichen Finanzen, dass über sie mit demokratischen Mitteln entschieden werden sollte. In repräsentativen Demokratien wie Japan übernimmt dies das Parlament stellvertretend für das Volk.
Doch macht das Parlament auch, was die Mehrheit der Bürger:innen finanzpolitisch will? Der Finanzwissenschaftler Yuta Kakegai von der Universität Ibaraki weist darauf hin, dass Japan die weltweit höchste Staatsverschuldung habe.
«Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist die öffentliche Meinung in Japan tatsächlich stärker für Budgetkürzungen und Schuldenabbau.» Mit anderen Worten: Der Staat macht Schulden, obwohl die öffentliche Meinung für Schuldenabbau einsteht. Es besteht also eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Meinung und dem Budget.
Woher kommt diese Diskrepanz? Ausgehend von dieser Fragestellung untersucht Kakegai in seinem aktuellen Buch «The Horizon of Fiscal Democracy: Autonomy, Diversity and Direct Democracy in Switzerland», was es braucht, um eine Fiskaldemokratie zu gewährleisten.

Kakegai ist der Meinung, dass Demokratie ohne demokratische Einflussnahme auf die Finanzen «eine unvollkommene Demokratie» sei. «Die Fiskaldemokratie ist notwendig, wenn die Grundsätze der Demokratie mit der wirtschaftlichen Realität jenseits von blossen Prämissen und Titeln gewährleistet werden sollen», sagt er. Das Vorbild des Finanzwissenschaftlers ist die Schweiz, wie schon der Untertitel seines Buchs klarmacht. Diese verfügt aus seiner Perspektive die Schlüssel zur Fiskaldemokratie.
Die Schweiz zeigt für Kakegai in der Praxis, dass in einem System, wo die öffentlichen Finanzen demokratisch kontrolliert werden, die Ausgaben nicht in die Höhe schnellen.
Die Staatsverschuldung der Schweiz lag 2023 bei 39,2 % des BIP. Im Vergleich zu Japan, das eine Schuldenquote von mehr als 200% des BIP aufweist, ist sie in diesem Bereich vorbildlich.
Auch die Schweiz verzeichnete Anfang der 1990er-Jahre nach dem Platzen der Immobilienblase ein Budgetdefizit. Mitte der 1990er-Jahre wurden jedoch entscheidende Reformen durchgeführt, die auch Kakegai im Buch analysiert. Darunter sind die Umstellung von der Umsatz- auf die Mehrwertsteuer, die Einführung einer Schuldenbremse und Zielvorgaben für den Abbau des Defizits. Und so habe die Schweiz wieder finanzielle Überschüsse generieren können.
Laut Kakegai wurden anfangs «neoliberale Reformen» mit dem Ziel einer «kleinen Regierung» vorgeschlagen. Doch die Mehrheiten in mehreren Volksabstimmungen hätten die radikalen Vorschläge modifiziert, während parallel das öffentliche Verständnis für Steuererhöhungen und Budgetdisziplin wuchs.
«In der Schweiz werden, sowohl bei nationalen als auch lokalen Abstimmungen, an jeden Haushalt Broschüren verteilt, um Informationen über Finanzen zu erklären», betont Kakegai. Er glaubt, dass diese Art von kumulierten Bemühungen eine wichtige Rolle dabei spielen, das Verständnis für Finanzen zu vertiefen.
«Es ist nicht die Demokratie, die die Schuldenkrise verursacht, sondern dass die Demokratie zum blossen Gerüst geworden ist.» Davon ist Kakegai überzeugt.
Die schweizerische Fiskaldemokratie
Was sind denn die Elemente, die in der Schweiz verhindern, dass von der Demokratie nur ein Gerüst bleibt? Kakegai erklärt im Buch zuerst, dass die Etablierung einer Finanzdemokratie «Partizipation» und «Deliberation» erfordert, und, dass die Schweiz in diesen beiden Bereichen besonders gut sei.
Die regelmässigen Volksabstimmungen, ausgelöst durch Volksinitiativen und Referenden, sind beispielhaft für die Kontrolle der Finanzen durch «Partizipation». Alle Schweizer Stimmberechtigten können eine Initiative oder ein Referendum lancieren, indem sie eine bestimmte Anzahl von Unterschriften sammeln.
Wie funktionieren Initiative und Referendum der Schweiz? Lesen Sie auch unseren Artikel zum Thema, der die Instrumente der direkten Demokratie in der Schweiz erklärt:

Mehr
Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz?
Auf lokaler Ebene ist die Beteiligung in Finanzbelangen am höchsten, sieht Kakegai. In über 1650 Schweizer Gemeinden entscheidet die Gemeindeversammlung, zu der alle Stimmberechtigten eingeladen sind, über lokale Steuern und Budgets. Manche Gemeinden, zum Beispiel die Stadt Aarau, haben einen Automatismus, dass nach einer Budgeterhöhung über eine bestimmte Schwelle zwingend eine Volksabstimmung stattfinden muss. Das ist in Japan anders, wo die gewählten Vertretenden auch auf lokaler Ebene freie Hand haben.
Ein einfacher Mehrheitsbeschluss in einer Volksabstimmung spiegelt jedoch nicht unbedingt den Willen der Minderheit wider. Daher sehen Finanzwissenschaftler:innen wie Kakegai nicht nur Partizipation als entscheidend für die demokratische Kontrolle, sondern auch «Deliberation», also eine Diskussion und Konsultation. Typisches Element dafür ist für Kakegai das Schweizer System der VernehmlassungExterner Link: Der Bundesrat hört Kantone, Gemeinden, politische Parteien und interessierte Organisationen an, bevor er eine Gesetzesvorlage ins Parlament schickt.
Japan verfügt zwar auch über Mechanismen zur Partizipation und Deliberation, wie Petitionen, Anträge und «Public CommentExterner Link», doch Kakegai ist der Meinung, dass diese nicht wirklich funktionieren. Auf lokaler Ebene kann man zwar Themen für eine Volksabstimmung vorschlagen, aber die Entscheidung darüber, ob sie durchgeführt werden, liegt in der Hand der Behörden. Zudem sind die Abstimmungsresultate nicht bindend. «Japan könnte auch ein System einführen, bei dem eine Abstimmung stattfindet, sobald eine bestimmte Anzahl von Unterschriften gesammelt wird», sagt Kakegai.
Grenzen der Partizipation und Deliberation
Doch der Wille der Bevölkerung führt auch in der Schweiz nicht immer zu idealen Finanzen. Partizipation und Deliberation sind auch in der Schweiz praktische Grenzen gesetzt, führt Kakegai weiter aus. Lange, wiederkehrende Prozesse führen im Lokalen immer wieder zu Problemen. So führte beispielsweise in der Stadt Olten das Referendum gegen eine vom Stadtparlament beschlossene Steuererhöhung dazu, dass das lokale Budget 2019 eingefroren wurde.
Manchmal können laut Kakegai dann «Einwände von Minderheiten» wirken. Etwa wenn ein Ort oder ein Kanton eine radikale Politik verfolgt. Zum Beispiel als der Kanton Obwalden 2005 degressive Steuern für Wohlhabende einführen wollte. Der kommunistische Politiker Josef Zysiadis verlegte damals medienwirksam seinen Wohnsitz aus der Westschweiz nach Obwalden, nachdem eine Mehrheit der Obwaldner:innen für das Steuergesetz gestimmt hatte. Zysiadis reichte dann zusammen mit Obwaldner:innen Beschwerden gegen das Gesetz beim Bundesgericht ein. Während das Gericht auf seine Beschwerde nicht eintrat, gab das Bundesgericht der Beschwerde der Obwaldner Bürger:innen recht. Damit war dieses Steuergesetz gekippt.
«Wenn Demokratie nur als Dialog verstanden wird, der auf Konsens abzielt, werden abweichende Meinungen ausgeschlossen. Auch wenn Einwände nicht als legitimer Weg erscheinen, sind Protest und zivilgesellschaftliches Engagement ein wichtiger Bestandteil der Demokratie», sagt Kakegai. In der Schweiz gebe es «eine Kultur des aktiven Engagements in sozialen Bewegungen», die die Grundlage für die Verwirklichung der Verfassungsbeschwerde anbot.
«In Japan tun die Leute oft so, als ob sie sich nicht an Demonstrationen beteiligen würden oder als ob es keinen Sinn hätte, dies zu tun», sagt Kakegai.
Hohe Wirksamkeit
In der Schweiz haben viele Menschen das Gefühl, dass ihnen das politische System ermöglicht, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Laut der jüngsten European Social Survey von 2023 liegt die Schweiz in der Frage unter 28 europäischen Ländern an der Spitze. Nur jede:r zehnte Schweizer Bürger:in hat demnach das Gefühl, die Politik gar nicht prägen zu können.
Editiert von Benjamin von Wyl

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


























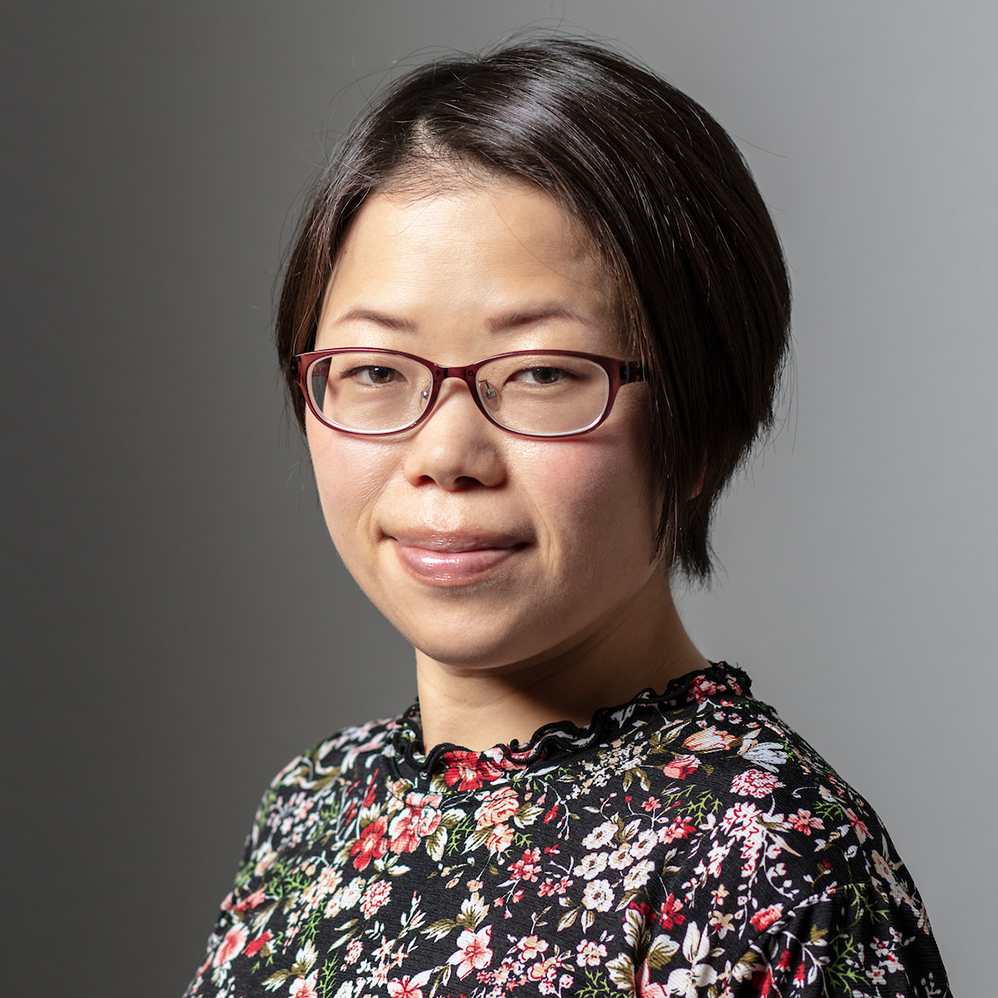
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch