
Ist ein «Cern» für Künstliche Intelligenz eine gute Idee?

Ein europäisches Zentrum für KI? Für Maria Grazia Giuffreda, Direktorin des Swiss National Supercomputing Centre, erschweren Nationalismus und Bürokratie das Projekt – während die Schweiz bereits eine Vorreiterrolle spielt.
Künstliche Intelligenz betrifft nicht nur Technologie und Wirtschaft, sondern auch Geopolitik. Seit dem KI-Boom der letzten zwei Jahre dominieren Diskussionen über ChatGPT, Google, Deepseek und andere Branchenriesen die Titelseiten der Zeitungen – oder treffender gesagt: die Homepages der Nachrichtenseiten.
Doch während das Thema rasant an Bedeutung gewinnt, kann Europa den USA und China bislang wenig entgegensetzen. Um die Abhängigkeit von ausländischen Technologien zu verringern und im globalen IT-Wettlauf nicht ins Hintertreffen zu geraten, versucht der Europa nun, durch gezielte öffentliche Investitionen eine digitale Teilautarkie aufzubauen.

Mehr
Künstliche Intelligenz: Diese Änderungen stehen an in der Schweiz
Ein viel diskutierter Ansatz ist die Schaffung eines europäischen Zentrums für künstliche Intelligenz nach dem Vorbild des Cern – mit einem geplanten Budget von 200 Milliarden Euro und möglicher Schweizer Beteiligung. Doch während Europa noch diskutiert, hat die Schweiz bereits konkrete Schritte unternommen: Im Oktober 2024 haben die Eidgenössischen Technischen Hochschulen Zürich und Lausanne das Schweizerische Nationale Institut für Künstliche Intelligenz (SNAI) gegründet. Ziel ist die Entwicklung eines transparenten, offenen und fairen Large Language Models (LLM). Auch die italienische Schweiz ist dank des Hochleistungsrechenzentrums CSCS in Lugano, das zur ETH Zürich gehört, in das Projekt eingebunden.
Das SNAI baut auf den Prinzipien der 2023 gestarteten Schweizer KI-Initiative auf, die als Reaktion auf die Dominanz weniger globaler Akteure im Bereich der generativen KI ins Leben gerufen wurde. Aktuell gibt es weltweit nur wenige Softwaresysteme zur Generierung von Text, Sprache oder Bildern, und diese stossen vor allem bei Expert:innen auf Skepsis – weniger wegen ihrer technischen Leistungen, sondern:
Die Grundsätze des SNAI unterscheiden sich kaum von denen des geplanten europäischen KI-Zentrums, das Ursula von der Leyen am 10. Februar 2025 angekündigt hat. «Die Schweizer KI-Initiative bringt die engagiertesten und besten Köpfe des Landes zusammen, um eine KI zu entwickeln, die die Werte der Schweiz und unserer Gesellschaft widerspiegelt», so Giuffreda. «Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbindung der Industrie, um Lösungen zu schaffen, die konkrete Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben.»
Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz erfordert nicht nur hervorragend ausgebildete Wissenschaftler:innen, sondern auch enorme Rechenkapazitäten. Europa kann im globalen Wettlauf nur dann aufholen, wenn seine Länder ihre Ressourcen bündeln – «sei es in Bezug auf Talente oder den Aufbau der nötigen Infrastruktur», betont Giuffreda.
Doch genau hier liegt ein Problem: Europa präsentiert sich oft nicht als geschlossen und geeint. Der Erfolg antieuropäischer Parteien in verschiedenen Ländern gefährdet die Kohäsion und könnte sich als Hindernis für den eigenen Fortschritt erweisen. «Meiner Meinung nach bleibt Europas grösstes Problem, dass wir alle ein bisschen nationalistisch sind. Jedes Land versucht, seine eigenen Interessen über das gemeinsame europäische Wohl zu stellen», kommentiert Giuffreda.

Mehr
Die Top-Geschichten der Woche abonnieren
Zudem ist Europa bislang die einzige Region, die umfassende Gesetzgebungen wie den AI ActExterner Link verabschiedet hat. Dieser stellt zwar einen Meilenstein im Schutz der Menschenrechte im KI-Bereich dar, könnte jedoch gleichzeitig die Innovationskraft bremsen und eine technologische Isolation bewirken.
Die Schweiz auf eigenem Kurs?
Die Schweiz verfolgt traditionell einen eigenständigen Weg in Technologiefragen und schirmt sich gegenüber externer Einflussnahme oft ab. «Ob es einem gefällt oder nicht, die Schweiz muss unabhängig bleiben. Eine eigene Infrastruktur ist essenziell, um weiterhin Talente zu fördern und eine treibende Kraft der Innovation zu bleiben. Im Bereich des Hochleistungsrechnens waren wir schon immer führend», erklärt Giuffreda. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken: «Europa muss geeinter werden, wenn es mit China und den USA konkurrieren will.»
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz bleibt somit eine Frage der Geopolitik, der Technologie und der Wirtschaft – aber auch, und vielleicht vor allem, der Kultur.
Übertragung aus dem Italienischen mit Hilfe des KI-Tools Claude: Camille Kündig

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards












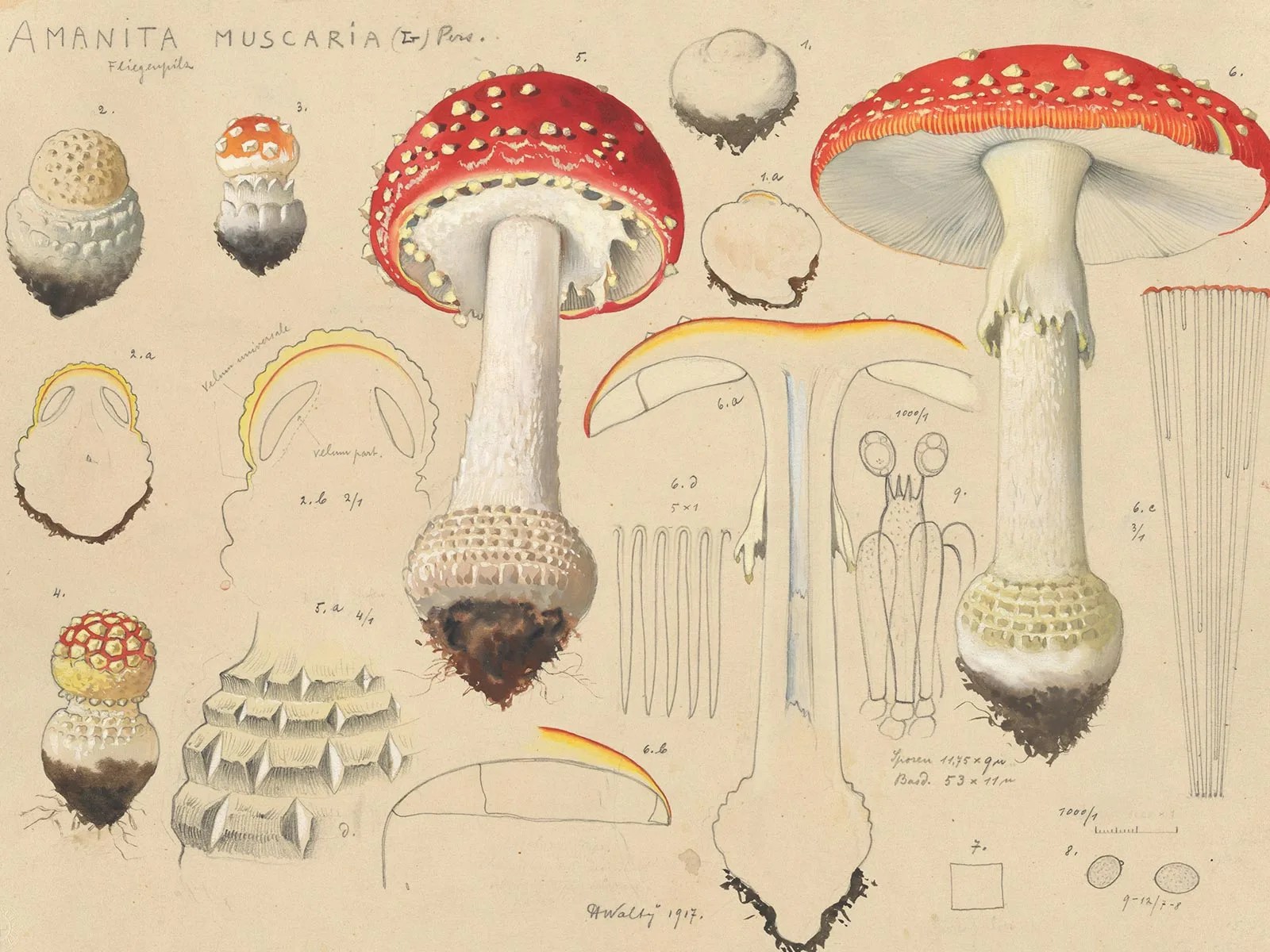













Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch