
Die Schweiz ist mehrsprachig, aber zweisprachiger Unterricht ist selten

Die Schweiz ist ein Musterbeispiel für ein Land, das mit mehreren Nationalsprachen bestens funktioniert. Doch zweisprachiger Unterricht an öffentlichen Schulen bleibt die Ausnahme – das zeigt, wie die Mehrsprachigkeit in der Schweiz gelebt wird.
Das aktuelle Schuljahr ist das letzte der bilingualen Schulklassen in Bern. Die Stadt will die zweisprachigen Klassen ab dem Sommer 2026 nicht mehr weiterführen. Die «Classes bilingues» wurden 2019 als Versuch ins Leben gerufen, mit Deutsch und Französisch als gleichwertige Sprachen im Unterricht. Das Angebot stiess auf ein grosses InteresseExterner Link. Doch vorbei: Im nächsten Sommer müssen 90 Kinder zurück in die reguläre Schule, zehn Lehrpersonen werden entlassen.
Als Grund für die AuflösungExterner Link der Klassen nennen die Behörden die Unvereinbarkeit der Lehrpläne der Deutsch- und Westschweiz sowie knapper Schulraum und Fachkräftemangel.
Für Virginie Borel ist die Schliessung der zweisprachigen Klassen «eine Katastrophe», wie sie im Gespräch mit Swissinfo sagt. Die Leiterin des Forums für die Zweisprachigkeit räumt zwar ein, dass das Führen von zweisprachigen Klassen eine Herausforderung gewesen sei, «alles musste neu erfunden werden».
Doch in den letzten sechs Jahren seien die «Classes bilingues» zu einem Hoffnungsträger geworden und die Vorteile würden inzwischen klar überwiegen. «In einer zweisprachigen Schule entdecken die Schüler:innen zusätzlich zu ihrer Muttersprache noch eine weitere Kultur, was sie offener und toleranter macht.»
Wie mehrsprachig ist die Schweiz?
Im Ausland ist die Schweiz als Nation mit mehreren Landessprachen bekannt. «Dadurch herrscht und hält sich gerade der Eindruck, die Schweizerinnen und Schweizer seien mehrsprachig – und zweisprachige Schulen ein etabliertes Modell», sagt ein Sprecher der Pädagogischen Hochschule Bern auf Anfrage von Swissinfo.
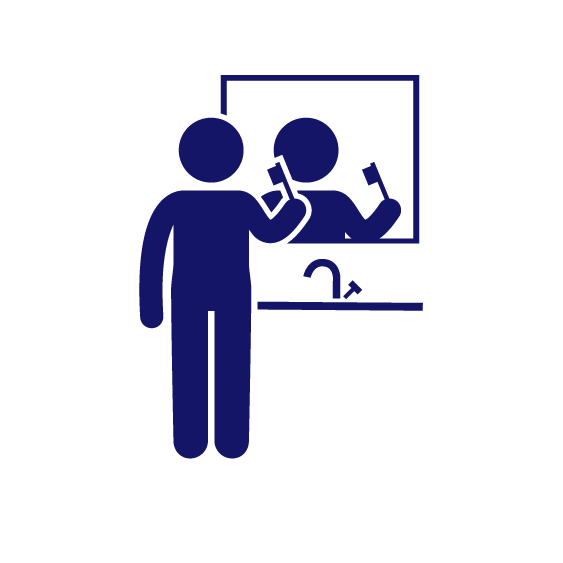
Mehr
Sprachen in der Schweiz
Doch die Realität sehe anders aus. «Die Berührungspunkte zwischen den Landesteilen und ihren Kulturen und Sprachen sind im Alltag vieler Menschen wenig ausgeprägt – was sich letztlich auch in den Schulungsangeboten äussert.»
Die Mehrsprachigkeit der Schweiz ist gesetzlich festgehalten. Der Artikel 70 der Bundesverfassung legt die vier Amtssprachen fest (Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch – mit Einschränkungen).
Mit der 2010 in Kraft getretenen SprachenverordnungExterner Link (revidiert 2022) wurden unter anderem neue Massnahmen zur Förderung des Austauschs zwischen den Sprachgemeinschaften, zur Förderung von Italienisch und Rätoromanisch in Graubünden sowie Unterstützung von mehrsprachigen Kantonen eingeführt.
«Die Sprachenvielfalt und ihre Förderung haben stark mit dem nationalen Zusammenhalt zu tun», sagt die PH Bern. In verschiedenen Kantonen und manchmal sogar im selben Kanton gibt es verschiedene Lösungen für den zweisprachigen Unterricht. «Damit ein Modell Erfolg hat, braucht es politische Unterstützung sowie eine Kommunikation, die auf wissenschaftliche Erkenntnisse hinweist.» Untersuchungen hätten gezeigt, dass zweisprachiger Unterricht wertvoll ist.
Virginie Borel sieht in der Schliessung der «Classes bilingues» in Bern auch eine Absage an die Mehrsprachigkeit, «einen Grundpfeiler der Demokratie». Sie betont, dass es nicht das Ziel sei, perfekt zweisprachige Menschen zu haben, sondern das Interesse gegenüber einer anderen Region und Kultur der Schweiz zu wecken.

Mehr
Das Schweizer Schulsystem erklärt
Zweisprachiger Unterricht in der Westschweiz
Das Institut für Mehrsprachigkeit hat für das Schuljahr 2021/22 ein «Inventar des zweisprachigen Unterrichts»Externer Link erstellt. Öffentliche zweisprachige Angebote ab der untersten Primarschulstufe findet man hauptsächlich in den zweisprachigen Kantonen Bern, Freiburg sowie in weiteren Kantonen der Westschweiz wie Neuenburg und Genf.
In Graubünden ist der zweisprachige Unterricht in Deutsch und Rätoromanisch weit verbreitet. Mit den weiteren Schulstufen kommen mehr Angebote dazu, von der Ober- bis zur Sekundarstufe. Auffallend ist dabei, dass der deutsch-französische Unterricht vor allem im Westen der Schweiz angeboten wird, während in der Deutschschweiz Englisch die erste Sprache für Immersionsunterricht ist.
Keine lange Tradition
Dabei haben zweisprachige Klassen oder Schulen in der Schweiz keine historische Tradition. Biel im Kanton Bern ist die einzige offiziell zweisprachige Stadt der Schweiz mit Strassenschildern auf Deutsch und Französisch. Doch auch dort existiert die zweisprachige Schule erst seit 2010Externer Link, die meisten Kinder besuchen weiterhin entweder eine deutsche oder eine französische Schule.
«Zweisprachiger oder immersiver Unterricht beginnt in unserem weiteren Kulturkreis in Kanada, Mitte der 1960er-Jahre», sagt Daniel Elmiger, assoziierter Professor für Linguistik und Fremdsprachendidaktik an der Universität Genf. Schon damals habe es in der Schweiz vergleichbare Modelle gegeben. Seit den 1990er-Jahren seien viele neue Angebote auf allen Schulstufen dazugekommen.
«Mir scheint also, dass man mittlerweile schon von einer Tradition sprechen kann, nur ist diese noch nicht so alt wie anderswo», sagt Elmiger. Doch verschiedene Formen von zwei- und mehrsprachigen Ausbildungen habe es schon lange gegeben, in mehrsprachigen Kantonen wie Graubünden oder Freiburg oder auch in anderen Bereichen, wie der Theologie, wo Latein noch lange eine grosse Bedeutung hatte, oder in der Hotellerie und Tourismusbranche.
Französisch unter Druck in der Deutschschweiz
Aktuelle Diskussionen um den Stellenwert des Französischunterrichts zeigen, dass die Mehrsprachigkeit in der Schweiz immer wieder zur Debatte steht. Das Zürcher Kantonsparlament hat Anfang September beschlossen, den Französischunterricht in der Primarschule, das sogenannte Frühfranzösisch, zu streichenExterner Link.
Die Entscheidung hat die Debatte um Frühfranzösisch neu entfacht, wenig später hat der Kanton St. Gallen nachgezogenExterner Link. Appenzell Innerrhoden und Uri haben Frühfranzösisch nie umgesetzt.
Steht der Zusammenhalt der Schweiz auf dem Spiel? Lesen Sie hier unseren Artikel:

Mehr
Dammbruch beim Frühfranzösisch: Driftet nun die Schweiz auseinander?
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider – aufgewachsen im zweisprachigen Kanton Bern – ist eine Befürworterin des FrühfranzösischenExterner Link. Sie hat das Thema in den Bundesrat gebracht, der nun die Arbeiten für ein neues GesetzExterner Link vorantreibt, welches Französisch in der Primarschule obligatorisch machen soll.
Virginie Borel glaubt auch, dass der Zeitpunkt zum Handeln gekommen ist. «Unsere Gesellschaft funktioniert gut, weil wir mehrere Sprachen und Identitäten haben. Aber das kommt nicht von selbst, wir müssen etwas dafür tun.»

In den meisten deutschsprachigen Kantonen wird in der Schule zuerst Englisch eingeführt, danach Französisch. In den französischsprachigen Regionen dagegen lernen die Kinder zuerst Deutsch – die Tendenz laufe sogar eher zu mehr Deutschunterricht, wie der Westschweiz-Korrespondent von SRF festhältExterner Link.
In Graubünden ist die erste obligatorische zusätzliche Sprache je nach Region Deutsch, Italienisch oder Rätoromanisch, im Tessin Französisch.

Zwar finden laut einer neuen Studie rund 77 % aller Befragten in der Schweiz, dass in der Schule als erste Fremdsprache eine andere Landessprache gelernt werden sollExterner Link.
Über 85 % glauben, dass das Beherrschen mehrerer Landessprachen den Zusammenhalt der Schweiz stärkt. Bei den jungen Menschen unter 24 wollen jedoch nur noch ein Drittel eine andere Landessprache als erste zusätzliche Sprache lernen.
Editiert von Balz Rigendinger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards





























Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch