
Was Neutralität in einer multipolaren Welt bedeutet
Nur eine konstante Neutralitätspolitik schafft in der Staatenwelt das Vertrauen, auf das die Schweiz angewiesen ist. Deshalb argumentiert Paul Widmer für die Annahme der Neutralitätsinitiative.
Auf der ganzen Welt gilt die Schweiz als Paradebeispiel eines neutralen Staates. Doch das steht heute auf der Kippe. Angesichts von massivem Druck aus dem Ausland wirkt unser Land verunsichert. Einige sehen den Sinn der Neutralität nicht mehr; für andere ist sie zum blossen Lippenbekenntnis verkommen. Sie meinen, man könne unter diesem Etikett alles verpacken. Doch dem ist nicht so. Schauen wir die Sache mal etwas grundsätzlicher an.
Worauf die Schweizer Neutralität baut
Die Neutralität ist ein Produkt der Realpolitik. Es geht ihr um die nationalen Interessen, um Unabhängigkeit und Sicherheit. Meistens entscheidet sich ein Staat erst für die Neutralität, nachdem er in der Aussenpolitik eine blutige Lektion einstecken musste, so die Schweiz 1515 mit der Schlacht von Marignano, Schweden mit Napoleon oder Österreich mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg.
Gewiss ist die Neutralität auf Eigennutz bedacht. Sie ist jedoch nicht unmoralisch. Verhielten sich alle Staaten wie die Neutralen, herrschte Frieden auf Erden. Aber das ist Wunschdenken. Die Grossmächte finden keinen Gefallen an der Neutralität. Sie wollen, dass man ihre Sache unterstützt – und nicht abseitssteht. Deshalb fördern sie lieber die kollektive Sicherheit, in welcher sie das Sagen haben.
Nun, daran ist im Prinzip nichts auszusetzen. Würde eine solche Friedensordnung funktionieren, wäre die Neutralität tatsächlich überflüssig. Aber wie funktioniert die kollektive Sicherheit heute? Meistens gar nicht. Seit es die Uno gibt, sind Hunderte von internationalen Konflikten ausgebrochen. Die Weltorganisation vermochte sie nur selten zu lösen. Ihr Versagen legitimiert stets von neuem die Neutralität. Um eine Wahrheit kommt man allerdings nicht umhin: Der neutrale Staat ist auf Gedeih und Verderben davon abhängig, dass die Grossmächte seine Neutralität respektieren. Was soll er tun, damit dies geschieht? Er muss mindestens drei Bedingungen erfüllen.
Erstens muss er militärisch alles unternehmen, um sein Territorium aus eigenen Kräften zu verteidigen. Das allein wird zwar nie ausreichen. Aber eine starke Armee ist Vorbedingung für den Respekt durch die andern. Zweitens muss er seine neutralitätsrechtlichen Pflichten korrekt wahrnehmen, um keine Vorwände für Interventionen zu liefern. Und drittens muss er auf diplomatischer Ebene glaubwürdig sein. Mit einer konstanten Politik schafft er Vertrauen. Nur dann wird das Interesse der Grossmächte an einer Verletzung der Neutralität geringer sein als die Furcht vor Reputationsschäden, die dadurch entstünden.
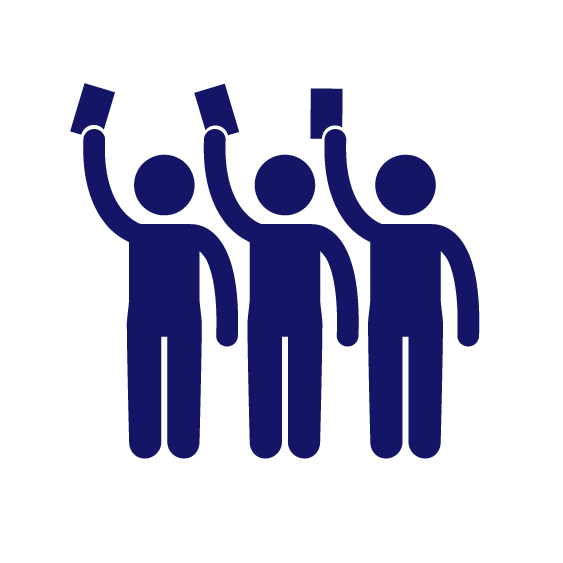
Mehr
Neutralität: Was macht die Schweiz im Kriegsfall?
Die Übernahme der Ukraine-Sanktionen
Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat sich vieles verändert. Am 28. Februar 2022 beschloss die Schweizer Regierung nach kurzem Zögern, die Russland-Sanktionen der EU zu übernehmen. Das war ein fataler Entscheid. Er löste überall Verwirrung aus. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die Schweiz sei nicht mehr neutral, und der damalige US-Präsident Joe Biden, sein Hauptantagonist, pflichtete ihm bei. Niemand wusste mehr, wofür die Schweiz steht. Dabei wäre die Ausgangslage für den Bundesrat relativ einfach gewesen. Er hätte den gleichen Weg eingeschlagen können wie 2014 nach dem russischen Überfall auf die Krim: keine Übernahme der EU-Sanktionen, aber eine strikte Verhinderung von Umgehungsgeschäften.
Die Situation verschlimmerte sich noch mit der misslungenen Bürgenstock-Konferenz. Die Schweiz verstiess, als sie ihre Guten Dienste anbieten wollte, gegen ihre eigenen Grundsätze der Diskretion und der Unparteilichkeit. Wie sollten die Russen noch teilnehmen, wenn der Bundesrat öffentlich diskutiert, ob er sie einladen wolle oder nicht und zudem mit einer der Kriegsparteien unverhohlen fraternisierte? Kein Wunder, dass sich die Schweiz ins Offside manövrierte und nachher nichts mehr zu vermitteln hatte.
Der Krieg in der Ukraine hat die Akzente in unserer bewaffneten Neutralität um einiges verschoben. Auf der einen Seite hat er – was bitter nötig war – den Willen zur Verteidigung gestärkt, auf der anderen Seite hat er den Sinn für die Unparteilichkeit geschwächt. Die bewaffnete Neutralität aber muss sich auf beides stützen können: auf eine starke Armee und ebenso auf eine glaubwürdige Diplomatie. Ohne das Vertrauen der Grossmächte in unsere Zuverlässigkeit nützt Neutralität nicht viel.
Ein klarer Kurs
Da dieses Vertrauen offensichtlich geschwunden ist, sollten wir uns bemühen, es so rasch als möglich wieder herzustellen. Das bedingt mindestens drei Massnahmen.
Erstens hält sich die Schweiz strikte an das Neutralitätsrecht. Es gibt kein Flunkern. Wir müssen den Mut haben, auch dann zur Neutralität zu stehen, wenn wir deswegen Kritik einstecken müssen. Dazu gehört auch, dass die Schweiz keine Kriegspartei mit Kriegsmaterial beliefert. An dieser Grundhaltung darf kein Zweifel aufkommen.
Aber das bedeutet nicht, mit verschränkten Armen dem Geschehen zuzuschauen. Vielmehr müssen wir uns aus der Falle befreien, in die das Parlament den Bundesrat gedrängt hat. Deshalb sollten die Parlamentarier die Erklärung zur Nichtwiederausfuhr im Kriegsmaterialgesetz so rasch als möglich ändern oder sogar ganz streichen. Denn es wird neutralitätsrechtlich nirgends verlangt, dass ein neutraler Staat die Abnehmer seines Kriegsmaterials verpflichtet, diese nicht weiterzugeben. Das heisst folglich: Die Schweiz übernimmt die Verantwortung für ihre Ausfuhren. Sie liefert wie bisher Waffen nur an nicht-kriegführende Staaten. Doch was die Abnehmer später mit den Waffen machen, liegt in deren eigener Verantwortung.
Zweitens hält sich die Schweiz, wie es das Neutralitätsrecht verlangt, unmissverständlich von militärischen Bündnissen fern. Daher muss sie sich auch Zurückhaltung in ihrer Annäherung an die Nato auferlegen. Dies ist umso mehr angezeigt, als sich die Welt auf ein multipolares Staatensystem zubewegt. Mit verschiedenen Machtzentren in Washington, Brüssel, Peking und den wichtigen Staaten des Südens dürfte eine zuverlässige Neutralität noch mehr gefragt sein als im bipolaren Kräfteverhältnis zwischen Washington und Moskau. Es ist somit unklug, ausgerechnet jetzt das zuverlässigste Unterpfand für unsere Stellung in der Welt zu gefährden.
Drittens soll sich die Schweiz nur den von der Uno verhängten Sanktionen anschliessen, nicht jedoch solchen von einzelnen Staaten oder der EU. Aber sie unternimmt alles, um deren Sanktionen nicht mit Umgehungsgeschäften zu unterlaufen. Deshalb friert sie den Handel oder die Dienstleistungen auf dem Niveau ein, das vor dem Erlass von Sanktionen herrschte. Das ist ein faires Vorgehen: keine Teilnahme an nicht universell dekretierten Sanktionen, aber auch kein Profit von Umgehungsgeschäften.
Ein Ja zur Neutralitätsinitiative
Die Schweiz ist mit ihrer Neutralität sehr gut gefahren. Vor mehr als 200 Jahren wurde ihre Neutralität auf dem Wiener Kongress völkerrechtlich anerkannt und als Friedensinstrument gewürdigt. Sie ist ungeschoren durch den Ersten, den Zweiten und den Kalten Krieg gekommen. Das sollte Grund genug sein, um vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken. Denn positive Erfahrungen stärken im Allgemeinen die Zuversicht.

Mehr
Was will die «Neutralitätsinitiative» an der Schweizer Politik ändern?
Nichts spricht dagegen, den wichtigsten Grundsatz unserer Aussenpolitik weiterhin zu befolgen. Aber das erfordert Überzeugung und Disziplin. Es gibt keine halbe Neutralität. Man ist neutral, oder man ist es nicht. Nur eine konstante Neutralitätspolitik schafft in der Staatenwelt das Vertrauen, auf das die Schweiz angewiesen ist.
Aus dieser Sicht begrüsse ich die Neutralitätsinitiative, über die in der Schweiz 2026 abgestimmt wird. Sie setzt ein klares Zeichen nach innen, aber auch nach aussen. Nach den jüngsten Verwirrungen auf höchster Regierungsebene würden die Schweizer Stimmberechtigten mit einem Ja unmissverständlich bezeugen, dass sie auch in einer multipolaren Welt das hochhalten, was den Erfolg unserer Aussenpolitik über die Jahrhunderte ausmachte: die bewaffnete Neutralität. Dies in der Verfassung festzuhalten, schwächt nicht unseren Staat, sondern stärkt den Frieden.
Editiert von Benjamin von Wyl
Die vom Autor geäusserten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Swissinfo wider.

Mehr
Hilft Neutralität dem Frieden? Ein Blick auf die Schweiz und ihre Guten Dienste

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards


























Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch