
Schweizer Film gegen UNO-Sanktionen im Irak

Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA finanziert einen Film über die Folgen der Sanktionen gegen den Irak. Gezeigt wird ein Tag im Leben eines Kindes.
Ein Tag im Leben eines kleinen Mädchens im Irak, nicht weit von Bagdad entfernt. Der Weg zur Schule führt über eine staubige Landstrasse. Die Schule: in der Bibliothek sind ein paar Duzend Bücher – für 200 Kinder. Die Bibliothek: sie besteht heute aus einem Schrank.
Über die Menschen im Mittleren Osten sagt man: Die Ägypter schreiben gerne, die Libanesen drucken gerne und die Iraker lesen gerne.
Die Schule sieht nicht wie eine Schule aus – sie hat nichts. Die Fenster sind eingeschlagen, Wasser bringt ein Laster zwei Mal die Woche, Toiletten gibt es gar nicht. Die Lehrer verdienen rund 10’000 irakische Dinar im Monat, rund 8 Schweizer Franken.
Früher war dies anders. Vor den Sanktionen waren die Klassenzimmer gut ausgerüstet, die Infrastruktur funktionierte.
Der Film beginnt aber mit einer Szene im Saddam-Krankenhaus in Bagdad. Eine Mutter will wissen, ob ihr leukämiekranker Sohn geheilt werden kann. An Medikamenten mangelt es. Der Arzt muss auswählen, welches der wartenden Kinder er behandeln kann. Die Szene endet mit der Einstellung auf dem verzweifelten Gesicht der Mutter, die erfährt, dass nicht ihr Sohn gerettet wird.
Der Tessiner Gianni Padlina, Produzent des Filmes, hat diese Sequenz während eines 10-tägigen Aufenthaltes im Irak gedreht und auch das Mädchen begleitet.
Wer das Projekt initiiert hat, ist unklar. Klar ist, dass die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA in der Schweiz das Projekt finanziert. Die Gemeinschafts-Produktion vom Tessiner Fernsehen und der DEZA sei nicht gegen die UNO gerichtet. Die DEZA ist selbst im Irak humanitär tätig und sieht die Konsequenzen der Sanktionen. Sie ist deshalb der Meinung, dass diese der Welt gezeigt werden sollen.
Nicht nur machte das DEZA 70’000 Franken locker, Walter Fust, der Direktor der DEZA organisierte auch einen «Türöffner» für Padlina: Hans von Sponeck.
Hans von Sponeck war Koordinator des humanitären Irak-Programmes «Öl für Lebensmittel» von der UNO und trat im April aus Protest gegen die Sanktionen von seinem Mandat zurück. Er bezeichnete bei seinem Rücktritt das Embargo «als absolut unwirksames Instrument».
Nicht Saddam sei gefallen, sondern jene, die man nicht berühren wollte, namentlich die Bevölkerung, die Frauen und Kinder. Durch den Stillstand der Wirtschaft und den Kollaps der Währung sei den meisten Irakern die Lebensgrundlage entzogen worden, sagte er gegenüber der «Süddeutschen Zeitung».
Von Sponeck wurde verschiedentlich vorgeworfen er arbeite zu sehr mit der irakischen Regierung zusammen. Von Sponeck konterte mit dem Hinweis er habe nie vergessen, wer die Zielgruppe der humanitären Hilfe sei. Wer aber eine gerechte Verteilung der Hilfsgüter erreichen wolle, müsse mit den irakischen Behörden kooperieren.
War es wegen dieser Kooperation, dass die Dreharbeiten zur Reportage nicht beeinflusst wurden? Von Sponeck erklärte gegenüber swissinfo, dass Padlina, der Produzent und er, die Kontaktperson, sich frei bewegen konnten im Irak. Sie konnten die Familie frei auswählen, die Drehorte, die Schule.
Laut Gianni Padlina ist Hans von Sponeck seit seinem Rücktritt eine Art Held im Irak. Sie hätten ein Interview mit Premierminister Tarek Aziz gemacht, während andere ausländische Fernsehstationen seit Monaten auf einen Termin warteten, erklärte Padlina gegenüber swissinfo.
Diese Bewegungsfreiheit kann als Propaganda interpretiert werden, als Komplizität mit der Regierung. Für Padlina ist jedoch klar: wenn er der Welt zeigt, wie es in und um Bagdad aussieht, dann zeigt er die Realität.
Bevor die Reportage über die Auswirkungen der Sanktionen im Irak über die Mattscheiben flimmert, visioniert ihn die DEZA. Ob «why» (vorgesehener Titel des Filmes) wirklich «propagandafrei» und «objektiv» ist, müssen dann die Zuschauerinnen und Zuschauer für sich entscheiden.
Rebecca Vermot

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards














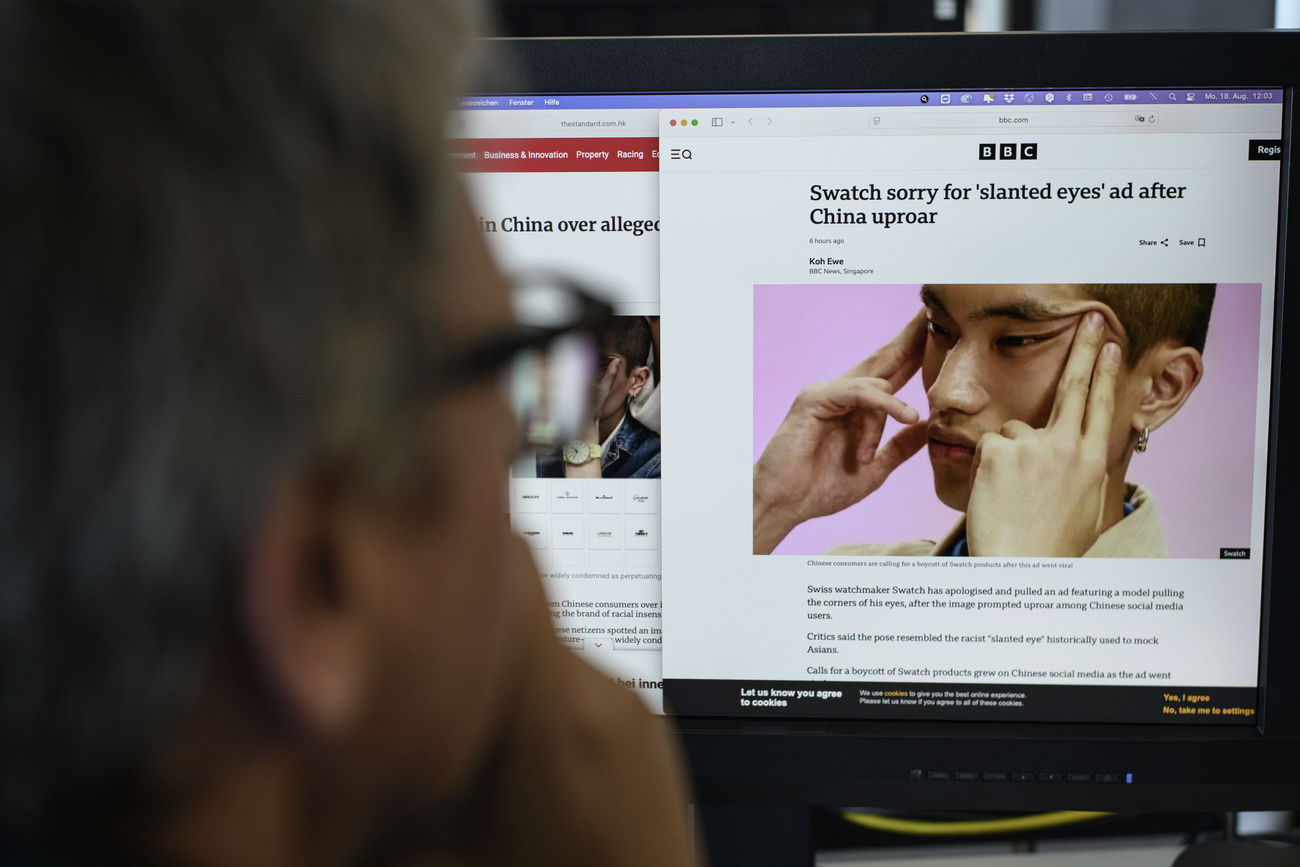



















Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch