
Leichte Tendenz zu einem Ja

Erste Trendrechnungen des Instituts gfs im Auftrag der SRG SSR idée suisse weisen auf ein Ja zur Personenfreizügigkeit hin.
Die Trendrechnungen bestätigen die letzten Umfragen vor dem heutigen Abstimmungssonntag.
Bis jetzt liegen die Resultate aus zehn Kantonen vor: Sieben nehmen die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Länder an, drei lehnen sie ab. Der Ja-Stimmen Anteil beträgt rund 55%.
Mit der Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die zehn neuen EU-Staaten kommt bereits die zweite Europa-Vorlage in diesem Jahr an die Urne. Am 5. Juni hatte das Stimmvolk mit 54,6% Ja gesagt zu den Verträgen von Schengen und Dublin zwischen der Schweiz und der EU (Teil der zweiten bilateralen Verträge).
Die Personenfreizügigkeit kam vors Volk, weil dagegen das fakultative Staatsvertrags-Referendum ergriffen und erfolgreich eingereicht worden war. Dazu sind in der Schweiz mindestens 50’000 gültige Unterschriften nötig.
Diverse Komitees sowohl aus der rechten politischen Ecke wie auch von linker Seite hatten zusammen fast 93’000 gültige Unterschriften gesammelt.
Teil des bilateralen Weges
Die Schweiz und die EU kennen unter den ersten bilateralen Verträgen bereits die Personenfreizügigkeit mit den bisherigen 15 Ländern der EU. Sie ist seit dem 1. Juni 2002 in Kraft und soll nun im Zuge der Erweiterung der EU auf die neuen zehn Länder ausgedehnt werden.
Die Freizügigkeit ermöglicht Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, in der EU zu arbeiten und sich dort niederzulassen. Umgekehrt gelten für EU-Bürgerinnen und Bürger dieselben Regeln in der Schweiz.
Mit der Begrenzung und nur schrittweisen Erhöhung der Anzahl Dauer- und Kurzaufenthalte bis 2011 soll die Einwanderung aus rein wirtschaftlichen Gründen verhindert werden.
Zudem sollen flankierende Massnahmen dafür sorgen, dass es zu keinem Missbrauch der Personenfreizügigkeit kommt. Dazu gehört die Kontrolle von Anstellungs- und Arbeitsbedingungen durch Arbeitsmarkt-Inspektoren.
Zwischen Angst und Hoffnung
Durch die Öffnung des Arbeitsmarktes befürchten die Gegner von rechts eine Masseneinwanderung aus den neuen EU-Staaten im Osten. Dadurch könnten das Schweizer Lohnniveau sowie Arbeitsplätze gefährdet werden. Zudem könnten ausländische Arbeitnehmer als Selbständigerwerbende das System unterwandern.
Für die linken Gegner gehen die flankierenden Massnahmen nicht weit genug. Sie befürchten, dass die Lohnabhängigen in der Schweiz durch die erweiterte Personenfreizügigkeit unter Druck geraten.
Die Befürworter, namentlich die Wirtschaft, betonen die Wichtigkeit der Abstimmung für die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Ein Nein würde diese nicht nur aufs Spiel setzen, sondern auch Arbeitsplätze vernichten, wenn die Schweiz abgeschottet würde.
Mehr ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden die Sozialwerke nicht gefährden, wie dies die Gegner behaupteten, sondern diese vielmehr stärken, indem mehr Menschen wieder Beiträge einzahlen würden.
Umfragen: Zuwachs für beide Lager
Nachdem die Befürworter in ersten Umfragen nur einen knappen Vorsprung vorzeigen konnten, haben sie gegen das Abstimmungsdatum hin an Boden gewonnen: Die letzte Umfrage im Auftrag der SRG SSR idée suisse zeigt eine Zustimmung von 50% unter den Befragten.
Aber auch das Lager der Gegner hat zugelegt: Es kann derzeit auf 38% der Stimmen hoffen. 12% sind noch unentschlossen.
Trotz diesem Unterschied kann am Sonntag mit einem sehr knappen Ausgang der Abstimmung gerechnet werden. Zeigten die Umfragen der letzten Jahre doch den Trend auf, dass sich das Lager der Gegner auf den Abstimmungssonntag hin meistens noch vergrössert.
swissinfo, Christian Raaflaub
Das bereits geltende Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Personenfreizügigkeit soll schrittweise und kontrolliert auf die zehn neuen EU-Staaten ausgedehnt werden.
Es sind dies Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern.
Gleichzeitig sollen die flankierenden Massnahmen verbessert werden, um Billiglöhne und missbräuchliche Arbeitsbedingungen wirksamer bekämpfen zu können.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards














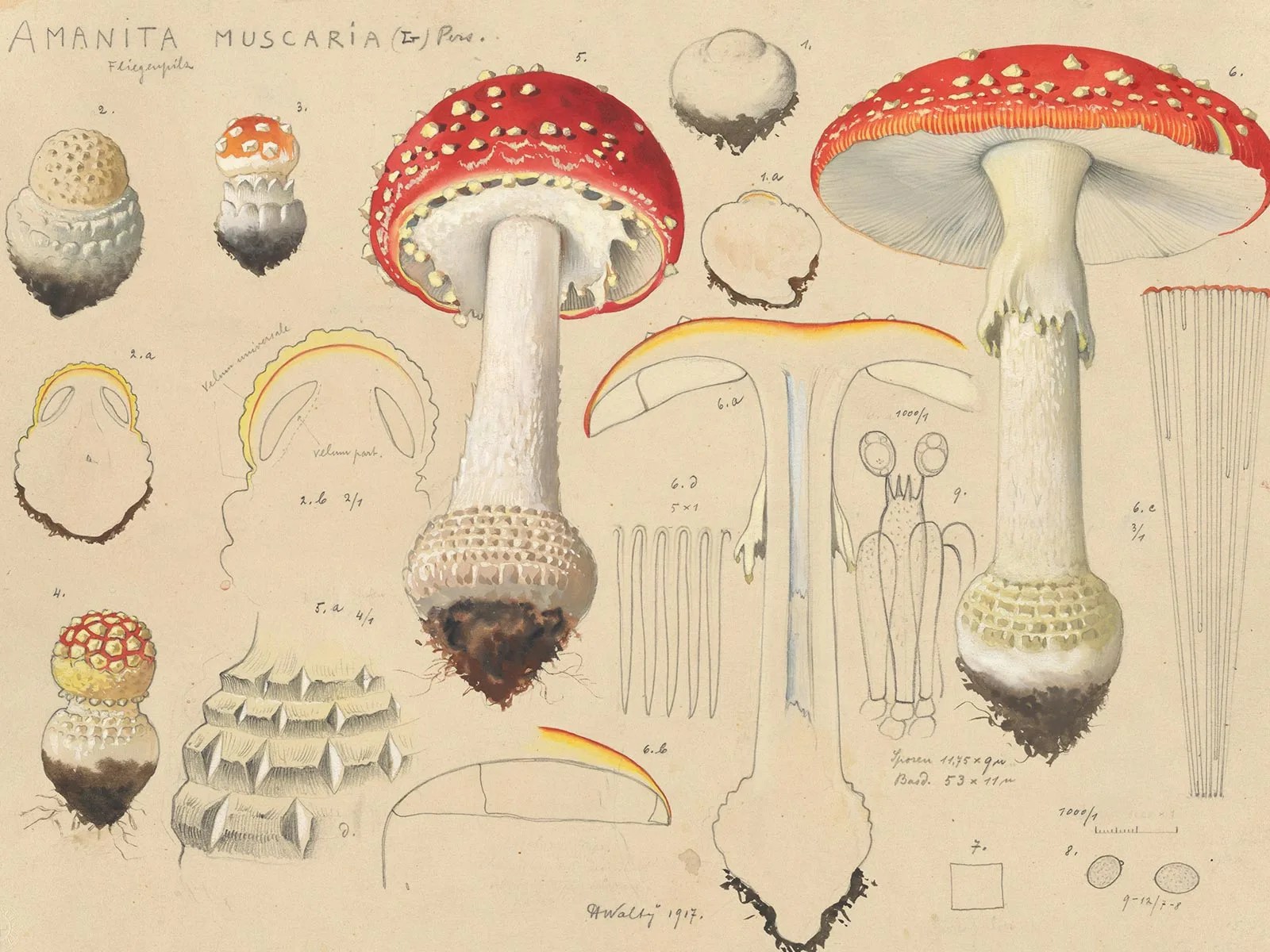












Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch