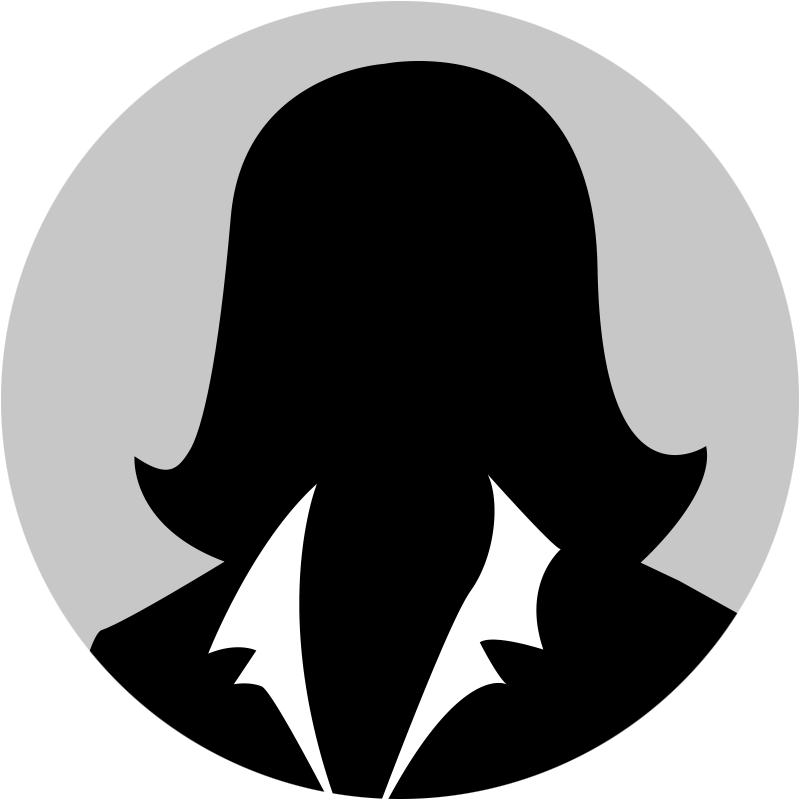Die Schulpolitik aus Sicht der drei Baselbieter Kandidierenden

Frühfranzösisch, Handyverbot, schulische Laufbahn und Kinderbetreuung: Was die Kandidierenden Sabine Bucher (GLP), Markus Eigenmann (FDP) und Caroline Mall (SVP) im Falle einer Wahl in den Baselbieter Regierungsrat beim Thema Schule bewegen möchten.
(Keystone-SDA) Die drei treten am 26. Oktober bei der Ersatzwahl für den Sitz von Monica Gschwind (FDP) an. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat die Kandidierenden gefragt, was sie bei schulischen Themen unternehmen würden, sollten sie die Bildungsdirektion erhalten. Das Fragebogen-Interview wurde schriftlich geführt.
Wie stehen Sie zur Abschaffung des Unterrichtsfachs Frühfranzösisch, wie es etwa kürzlich der Zürcher Kantonsrat beschlossen hat?
Sabine Bucher: Ich bin für die Abschaffung von Frühfranzösisch, damit auf Primarstufe vertieft Deutsch unterrichtet werden kann und so alle Fächer in der Sekundarschule leichter fallen (insbesondere besseres Leseverständnis). Dann bleibt in der Sekundarschule mehr Zeit für intensiven Französischunterricht. Dadurch werden alle Fächer – auch Französisch – gestärkt.
Markus Eigenmann: Unterdessen ist klar, dass die Ziele des Sprachenkonzepts insbesondere im Fach Französisch nicht erreicht werden – die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule sind nicht gut genug. Es ist somit klar, dass es Änderungen braucht. Ob das eine komplette Abschaffung des Französichunterrichts auf der Primarstufe oder ein späterer Beginn mit mehr Wochenlektionen sein wird, ist für mich noch offen. Es laufen aktuell ja noch Befragungen und Abklärungen dazu. Wichtig ist, dass die Änderungen mit den Nachbarkantonen in der Region Basel abgesprochen sind, um keine Umzugshürden zu errichten.
Caroline Mall: Die Primarschule ist heute bereits überladen. Die Kinder sollen zuerst sicher Deutsch lernen, bevor eine weitere Fremdsprache eingeführt wird. Ein späterer Beginn mit besserem Fundament ist pädagogisch sinnvoller. Wir brauchen Qualität vor Quantität.
Gemäss Angaben der Bildungsdirektion ist die Anschlussfähigkeit von Schülerinnen und Schüler aus dem Leistungszug A an die Sekundarstufe II eine Herausforderung. Wo würden Sie den Hebel ansetzen, damit mehr Jugendliche in schwierigen Ausgangslagen zum Beispiel den Einstieg in eine Berufslehre schaffen?
Bucher: Schön wäre, vermehrt auf Stärken zu setzen. Die heutige Abwahlmöglichkeit einer Fremdsprache ist ein erster Schritt in diese Richtung. Die berufliche Orientierung wird aktuell weiter ausgebaut, was sicher auch hilfreich ist. Und ausserdem gibt es bereits heute gute Brückenangebote, die weiter optimiert werden können.
Eigenmann: Wichtige Ansatzpunkte wären für mich eine eitere Stärkung der Berufsorientierung insbesondere im Leistungszug A, Spezialisierung der Lehrpersonenaus- und -weiterbildung für den Leistungszug A, bessere Vernetzung der Lehrpersonen mit ausbildenden Betrieben sowie eine stärkere Einbindung der Erziehungsberechtigten in den Berufswahlprozess.
Mall: Wir müssen den A-Zug gezielt stärken. Schülerinnen und Schüler sollen stärker an ihren Fertigkeiten abgeholt und praxisorientierter unterrichtet werden. Dazu braucht es mehr Berufsorientierung, vermehrte Schnupperlehren und eine enge Zusammenarbeit mit Lehrbetrieben. So schaffen wir echte Perspektiven und erleichtern den direkten Anschluss an die Berufslehre
Sind Sie für ein Handyverbot an Schulen?
Bucher: Grundsätzlich ja, insbesondere an Primarschulen.
Eigenmann: Das kommt sehr auf die Schulstufe drauf an. Auf der Primarstufe sehe ich keine Notwendigkeit für Handys im Unterricht. Auf den Sekundarstufen mag es phasenweise Sinn machen, Handys im Unterricht als Hilfsmittel zu nutzen.
Mall: Die Kompetenz soll bei den Schulleitungen und Lehrpersonen sein, wie sie mit dieser Thematik umgehen. Umfragen haben ergeben, dass sie auf der Zielgeraden sind. Ein ausgesprochenes Verbot des Kantons würde die Autonomie der Schulen schwächen. Eine Empfehlung oder ein Handbuch seitens Kantons wäre in diesem Zusammenhang sinnvoll.
Bräuchte es hierzu eine kantonale Regelung oder sollen das die Schulen für sich entscheiden?
Bucher: Ich stelle sehr in Frage, ob es ein von oben herab diktiertes, kantonales Verbot braucht. Die Schulleitungen haben bereits heute die Kompetenz solche Massnahmen umzusetzen und können viel flexibler reagieren. Und dann vielleicht (ab Sekundarstufe) auch mal Experimente machen mit den Lernenden, zum Beispiel wie es ist, zwei Wochen lang die Geräte unbeschränkt nutzen zu dürfen, und sich anschliessend über diese Erfahrungen austauschen.
Eigenmann: Die Frage ist auf Stufe der einzelnen Schule zu regeln – es braucht meines Erachtens keine kantonsweite Regelung. Die Schulleitungen müssen aber den Mut haben, für die eigene Schule Regeln zu definieren und auch durchzusetzen.
Mall: Der Kanton kann Empfehlungen und Leitlinien geben, aber die konkrete Umsetzung gehört in die Hände der Schulleitungen, denn dort kennt man die jeweilige Situation am besten.
Die Volksinitiative «Gebührenfreie Kinderbetreuung für alle Familien» der SP ist noch hängig. Wie stehen Sie zur Forderung, dass Kitas zum Service public gehören sollten?
Bucher: Eine teilweise Grundfinanzierung durch den Kanton könnte ins Auge gefasst werden. Es wäre schön, wenn auch die Wirtschaft einen Teil übernehmen würde, wie dies gewisse Arbeitgebende heute schon tun. Je tiefer das Familieneinkommen, desto mehr Unterstützung ist nötig. Dabei soll sich die staatliche Unterstützung nicht auf Kitas beschränken. Insbesondere in kleineren Gemeinden sind z.B. auch Tagesfamilien sinnvoll und unterstützungswürdig.
Eigenmann: Für die Form der Kinderbetreuung soll weiterhin Wahlfreiheit gelten. Angesichts des Fachkräftemangels und für den weiteren Karriereverlauf insbesondere von Frauen ist es aber sinnvoll, stärkere Anreize zu schaffen, dass Elternpaare insgesamt zu einem höheren Pensum arbeiten gehen als heute. Wichtig ist, dass die heutigen Anreize für tiefe Erwerbspensen in den Subventionsreglementen beseitigt werden: Betreuungsgutscheine sollen unabhängig vom tatsächlich geleisteten Arbeitspensum gewährt werden.
Mall: Die Initiative geht zu weit und ist finanziell nicht tragbar. Der Gegenvorschlag der Regierung ist deutlich angemessener, weil er Familien und Betreuungsangebote gezielt unterstützt. Entscheidend ist, dass wir massvolle Lösungen umsetzen, die von der Bevölkerung und den Steuerzahlenden mitgetragen werden können, ohne den Kanton finanziell zu überlasten. Nicht alles gehört zum Service public. Es braucht Augenmass statt flächendeckende Gratisangebote.