
Zwischen Ergriffenheit und Lachanfall

Für die einen bedeutet sie Nationalstolz und Gottverbundenheit, andere finden sie bedeutungslos und lachen über sie: die Schweizer Landeshymne.
Und viele Schweizerinnen und Schweizer kennen den «Schweizerpsalm» gar nicht, geschweige denn seinen Text.
Unmodern, nationalistisch, schwülstig, pathetisch, realitätsfremd, männer- und ich-bezogen: Der Kritiken sind viele, denen die Nationalhymne immer wieder ausgesetzt ist. 1961 provisorisch, 1981 definitiv als Landeshymne eingeführt, hat der Schweizerpsalm aber bisher alle Änderungs- oder Abschaffungsversuche überlebt.
Der jüngste Vorstoss auf politischer Ebene, den Schweizerpsalm durch eine zeitgemässere Landeshymne zu ersetzen, ist im Schweizer Parlament noch hängig. Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, hat aber bereits klar gemacht: Er ist für die Beibehaltung des Schweizerpsalms, auch wenn er Mängel in Text und Melodie einräumt.
Würdig, aber vielen unbekannt
Der Schweizerpsalm sei dank seiner Bekanntheit eine würdige Landeshymne, schrieb der Bundesrat auf eine Motion der sozialdemokratischen Nationalrätin Margret Kiener Nellen. Für viele habe gerade ihr pathetischer und religiöser Charakter ein identitätsstiftendes Moment.
Die Landesregierung empfiehlt dem Parlament deshalb die Ablehnung der Motion. Wann sie behandelt wird, ist noch offen.
Stellt sich die Frage, ob der Bundesrat in Bezug auf die Bekanntheit der Landeshymne nicht einer Illusion erliegt.
Verschiedene Umfragen der letzten Jahre haben nämlich gezeigt, dass mindestens ein Drittel der Befragten den Schweizerpsalm überhaupt nicht kennt und nur ein geringer Prozentsatz den Text – er beginnt mit «Trittst im Morgenrot daher» – kann.
Ersatzvorschläge chancenlos
Ersatzvorschläge hatten bisher keine Chance. Wie das historische Lexikon der Schweiz schreibt, konnten sich Gegenvorschläge wie «O mein Heimatland» von Gottfried Keller und Wilhelm Baumgartner, «Heil dir, mein Schweizerland» aus Otto Barblans Calven-Festspiel oder «Vaterland, hoch und schön» von Hermann Suter nicht durchsetzen.
Ebenfalls keine Chance hatte 1986 der Versuch des Zürcher Nationalrats Fritz Meier (Nationale Aktion), den Schweizerpsalm – zwecks Reverenzerweisung an die französischsprachigen Eidgenossen – durch «Roulez tambours» von Henri-Frédéric Amiel zu ersetzen.
Auch keine Neuschöpfungen
Auch Neuschöpfungen schafften es bisher nicht, den Schweizerpsalm zu verdrängen. Dazu gehören etwa der Rütlischwur aus Schillers «Wilhelm Tell» in der Vertonung von Robert Blum oder das «Schweizerlied» von Herbert Meier und Paul Burkhard.
Mit dem Konkurs der Trägerstiftung endete 1999 auch der Versuch der Stiftung Pro CH 98, das Werk «Mit aller Kraft will ich dem Lande nützen» zur neuen Landeshymne empor zu hieven. Die Hymne war im Oktober 1998 in Luzern uraufgeführt worden. Als Komponist und Texter zeichnete der aus dem aargauischen Wettingen stammende Christian Daniel Jakob.
swissinfo und Ursula Santschi (sda)
Bis ins späte 19. Jahrhundert kannte die Schweiz keine Tradition der Landeshymne.
Bis 1961 wurde häufig das Lied «Rufst du, mein Vaterland» verwendet. Der Bundesstaat hatte damit ein Lied gewählt, das auf der Melodie der britischen Hymne «God Save the King» von Henry Carey und dem Text des 1811 von Johann Rudolf Wyss verfassten Gedichts «Rufst Du mein Vaterland» basierte.
Die Kritik an diesem Lied führte 1961 zum Beschluss des Bundesrats, den populären Schweizerpsalm zunächst provisorisch als offizielle Landeshymne einzusetzen. Eine Vernehmlassung unter den Kantonen führte 1981 zur definitiven Einführung.
Der Text stammt vom Zürcher Leonhard Widmer, die Melodie vom Wettinger Pater Alberich Zwyssig.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards















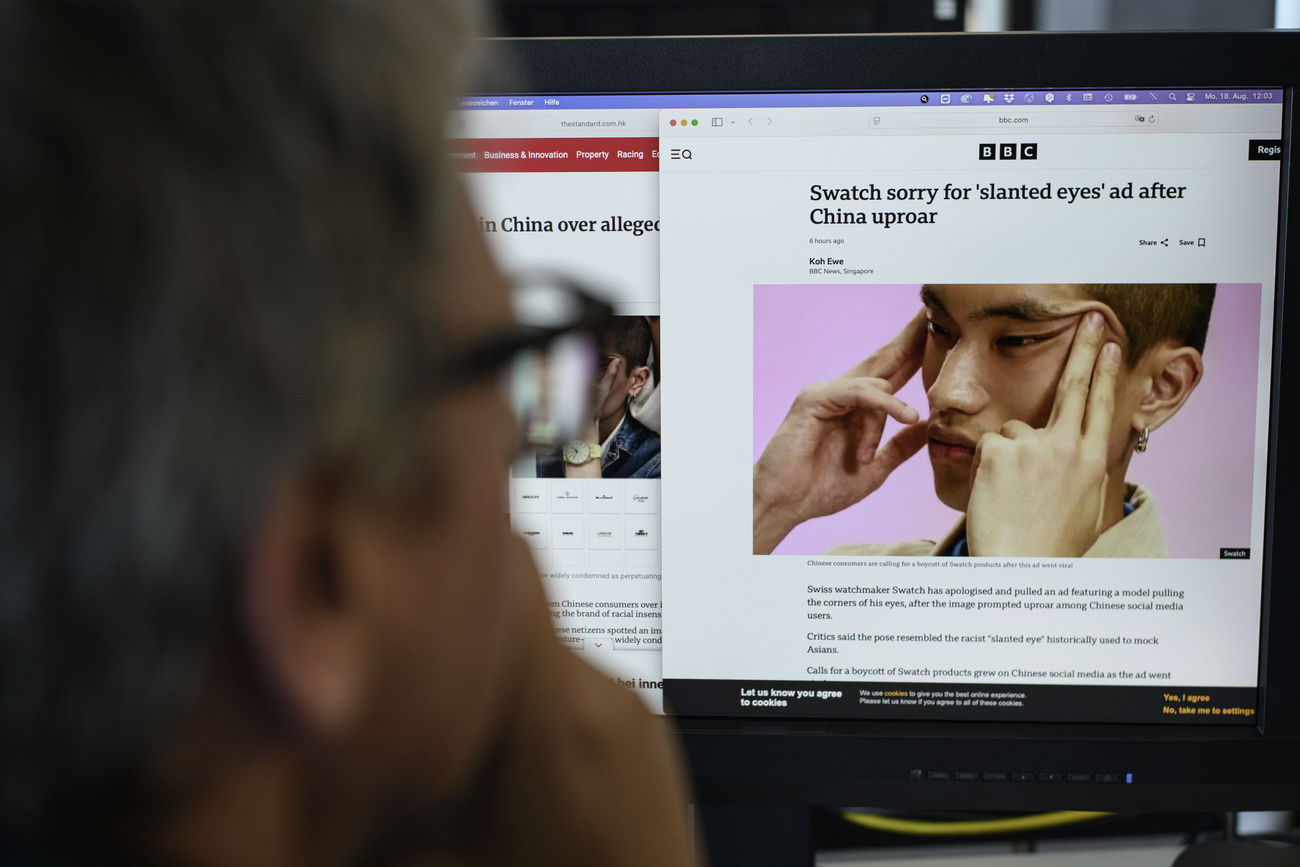














![Félix Vallotton - Gabrielle Vallotton Seated in a Rocking Chair [1902]](https://www.swissinfo.ch/content/wp-content/uploads/sites/13/2025/06/53715547480_948a0f3612_o.jpg?ver=af84b45e)



Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch