
Grönland: Glasfaserkabel zeigen Auswirkungen der Gletscherschmelze

Das Abbrechen grosser Eisblöcke von Gletschern beschleunigt das Schmelzen der arktischen Eiskappe in Grönland. Zum ersten Mal zeigte dies eine internationale Forschungsgruppe auf – dank einer Glasfasertechnologie, die auch bei der Untersuchung der Schweizer Gletscher eingesetzt wird.
Die Eiskappe in Grönland schmilzt immer schneller. Seit 2002 hat sie durchschnittlich rund 270 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr verlorenExterner Link, was zu einem Anstieg des Meeresspiegels um fast zwei Zentimeter geführt hat.
Das Abbrechen grosser Eisblöcke gehört zu den sichtbarsten Folgen des durch den Klimawandel verursachten Masseverlusts der Eiskappe. Allerdings verstärkt auch ein anderes Phänomen das Schmelzen zusätzlich: Wenn ein Eisberg ins Meer stürzt, der Gletscher also kalbt, bringt dies wärmeres Wasser an die Oberfläche, was den Schmelzprozess weiter beschleunigt.
Diese Entdeckung machte eine internationale Forschungsgruppe unter der Leitung der Universitäten Zürich und Washington. Zum ersten Mal wurde gemessen, wie das Abbrechen des Eises den Rückgang der arktischen Eiskappe in Grönland beschleunigt.
Die Studie ist Teil des Projekts GreenfjordExterner Link des Schweizer Polarinstituts und wurde am 13. August in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.
«Wir haben den Prozess besser verstanden, der abläuft, wenn Eis ins Meer fällt: Das Eis bricht nicht nur ab, sondern verstärkt auch das Schmelzen unter der Wasseroberfläche», sagt Andreas Vieli, Professor für Glaziologie an der Universität Zürich und Mitautor der Studie, gegenüber Swissinfo.
Diese Beobachtungen helfen, das Wissen über das grönländische Eis zu verbessern. Dieses erstreckt sich über eine Fläche, die etwa 40-mal so gross ist wie die Schweiz. Es handelt sich um ein fragiles System, dessen vollständiges Abschmelzen gravierende Folgen für die Meeresströmungen, das globale Klima und die Küstenregionen der Erde hätte.
Das Schmelzen der Gletscher hat globale Folgen:
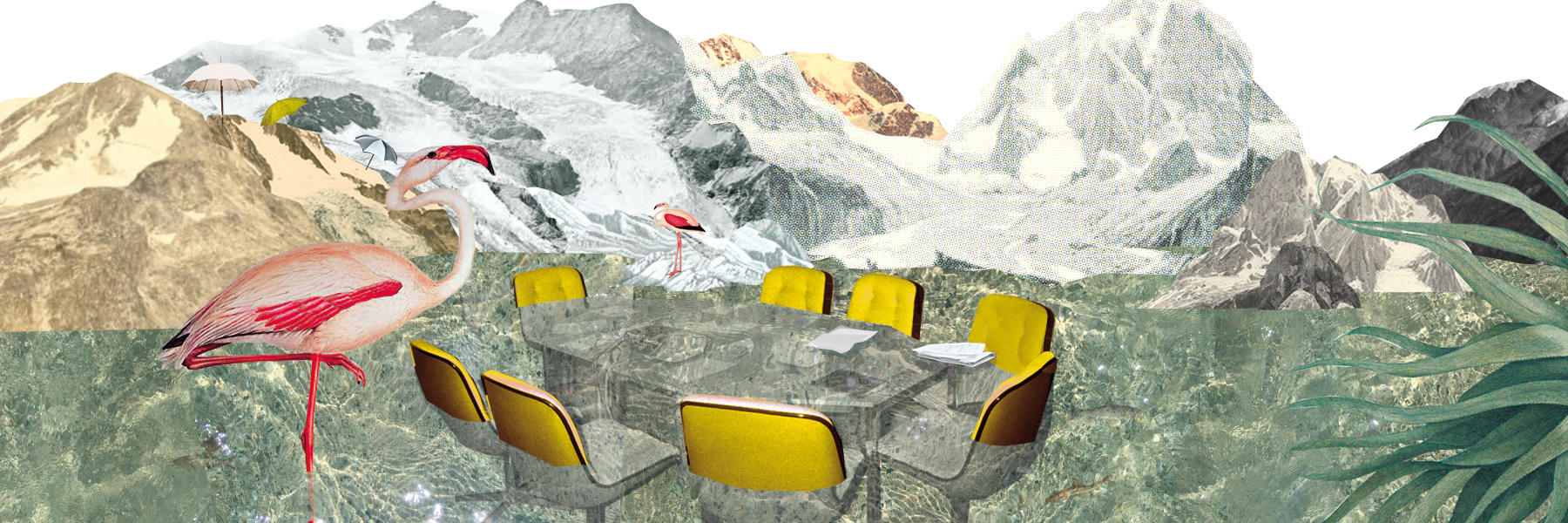
Mehr
Warum die Gletscherschmelze uns alle betrifft
Unterseeische Wellen bringen warmes Wasser an die Oberfläche
Forschende der Universitäten Zürich und Washington haben die Auswirkungen des Abbruchs von Eisbergen am Gletscher Eqalorutsit Kangilliit Sermiat in einem Fjord im Süden Grönlands untersucht.
Von diesem Gletscher brechen jährlich etwa 3,6 Kubikkilometer Eis ab. Das entspricht fast dem Dreifachen Volumen des Rhonegletschers in den Schweizer Alpen.
Der Einschlag des Eises ins Meer erzeugt zunächst Oberflächenwellen, ähnlich einem Tsunami, welche die obere Wasserschicht aufwühlen. Danach entstehen jedoch auch tieferliegende Wellen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind.
Diese können so hoch wie Wolkenkratzer sein und transportieren warmes Wasser vom Meeresboden zur Oberfläche, wodurch die Schmelz- und Erosionsprozesse an der Gletscherfront weiter verstärkt werden.
Sehen Sie sich die Bilder vom Abbruch des Eises eines grönländischen Gletschers an:
Dominik Gräff, Forscher an der Universität Washington und Hauptautor der Studie, vergleicht diesen Prozess mit dem Schmelzen von Eiswürfeln in einem heissen Getränk.
Wenn man das Getränk nicht umrührt, bildet sich eine Schicht kalten Wassers um den Eiswürfel, die ihn von der wärmeren Flüssigkeit isoliert. Rührt man jedoch um, wird diese Schicht gestört und der Eiswürfel schmilzt deutlich schneller.
Im Fall der grönländischen Eiskappe erfolgt laut Vieli etwa die Hälfte des aktuellen Masseverlusts durch unterseeische Schmelzprozesse und das Abbrechen von Eisbergen.
Glasfaserkabel auf Grönlands Meeresboden
Um die Vorgänge in der Tiefe zu messen, haben die Forschenden ein zehn Kilometer langes Glasfaserkabel auf dem Meeresboden verlegt. Mithilfe einer Technologie namens «Distributed Acoustic Sensing» (DAS) konnten sie Veränderungen in der Faser – Dehnung oder Kompression – erfassen, die durch unterseeische Wellen verursacht wurden.
«Mit dem Glasfaserkabel konnten wir diesen unglaublichen Multiplikationseffekt auf die Eisbergkalbung messen. Das war bisher nicht möglich», wird Gräff in einer Mitteilung der Universität ZürichExterner Link zitiert.

Die Bedeutung des Meerwassers und der Dynamik beim Abbruch von Eisbergen ist seit langer Zeit bekannt. Allerdings ist es äusserst schwierig, diese Prozesse direkt vor Ort zu messen, da die grosse Anzahl von Eisbergen in den Fjorden ein ständiges Risiko durch herabfallende Eisblöcke darstellt.
Zudem können herkömmliche Fernerkundungsmethoden, die auf Satelliten basieren, nicht unter die Wasseroberfläche blicken, wo die entscheidenden Wechselwirkungen zwischen Gletschern und Meerwasser stattfinden, betont Vieli. «Dank des Glasfaserkabels war es, als hätten wir tausend Sensoren unter der Gletscherfront.»
Technologie im Einsatz bei Schweizer Gletschern
Der Einsatz von Glasfaser zur Untersuchung von Gletschern ist eine relativ neue Technik. Forschende in der Schweiz und in anderen Gebirgsregionen wie Alaska nutzen sie, um Mikrovibrationen im Gletscher und potenzielle Frühwarnzeichen für Instabilität zu erfassen.
«Die Glasfaser ermöglicht es uns, extrem schwache seismische Ereignisse zu erkennen, die mit anderen Technologien nicht messbar wären», sagt Thomas Hudson, Seismologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), gegenüber Swissinfo.
Im Jahr 2023 installierte Hudson 1,2 Kilometer Glasfaserkabel auf dem Gornergletscher im Kanton Wallis und registrierte tausende seismische Wellen. Diese Vibrationen können Hinweise auf Veränderungen im Innern des Eises liefern.
Forschungsprojekte mit Glasfasertechnologie in der Schweiz eröffnen neue Möglichkeiten zur Überwachung von Gletschern und Naturgefahren:

Mehr
Glasfaserkabel auf Gletschern können Naturkatastrophen früher erkennbar machen
Mit Glasfaser erhält man auch Informationen über die Struktur und Zusammensetzung des Eises. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen seismischen Sensoren, die an bestimmten Punkten installiert werden, liegt in der Möglichkeit, viel grössere Flächen zu überwachen, da die Installation vergleichsweise einfach ist.
Diese Technologie würde es ermöglichen, ganze Gletscher zu überwachen, selbst in schwer zugänglichen Regionen.
Editiert von Reto Gysi von Wartburg. Übertragung aus dem Italienischen mithilfe von Deepl: Christian Raaflaub

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards



























Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch