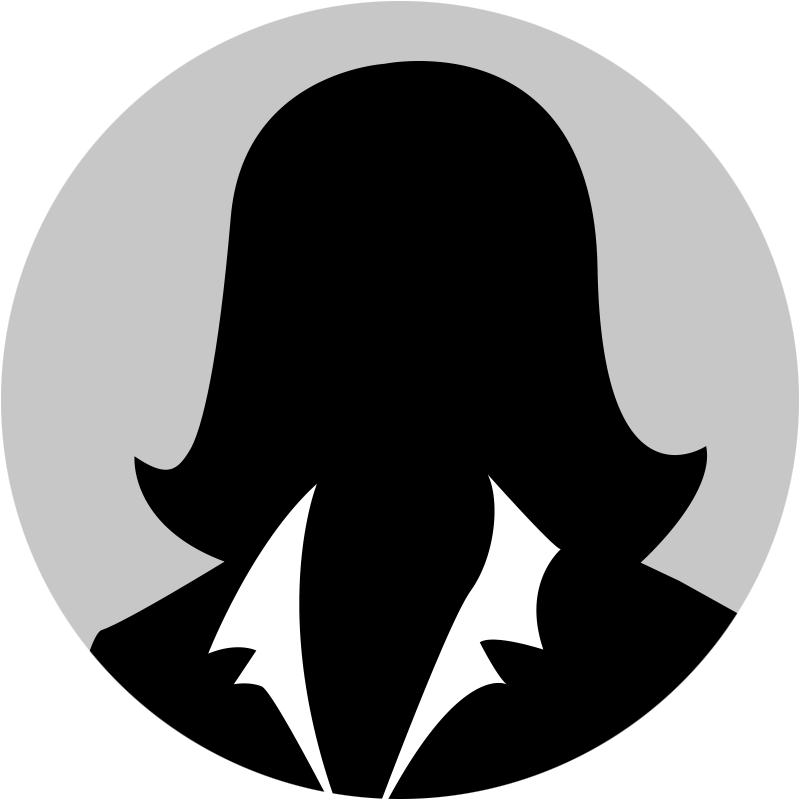Trotz optimierter Gewässerregulierung sind Hochwasser möglich

Seit der Hochwasserkatastrophe von 2005 hat der Kanton Bern seinen Umgang mit Naturgefahren dieser Art verbessert. Laut den Verantwortlichen ist die Gewässerregulierung so gut, wie es die heutigen Mittel zulassen, doch solche Katastrophen würden sich auch in Zukunft nie ganz verhindern lassen.
(Keystone-SDA) Eines der zentralen Elemente ist der Hochwasser-Entlastungsstollen in Thun, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Freitag mitteilte. Dieser wurde 2009 in Betrieb genommen, ist 1,2 Kilometer lang und hilft, dass im Bedarfsfall bis zu 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde zusätzlich aus dem Thunersee abfliessen können.
Gleichzeitig können heute der Thunersee und die Jurarandseen vor einem Hochwasser leicht abgesenkt werden, um die Aufnahmekapazität zu vergrössern. Damit könne zusätzliches Rückhaltevolumen im See freigegeben werden.
Dies funktioniere aber nur, wenn die Hochwasser früh erkannt werden, hiess es weiter. Seit 2005 seien die Wetter- und Abflussvorhersagen dank hochaufgelöster Modelle deutlich präziser geworden. Diese Modelle brauchen aktuelle Daten in Form von Niederschlags- und Abflussmengen. Die Daten stammen aus dem eigenen Messnetz des Kantons Bern und werden ergänzt mit Daten vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz und dem Bundesamt für Umwelt.
Extremereignisse bleiben unvermeidbar
Gewässerregulierung kann beeinflussen, wie viel Wasser kommt und wie lange es kommt. Dennoch betont der Kanton, dass die Gewässerregulierung auch an ihre Grenzen stossen kann, wenn zu viel Wasser kommt. «Hochwasser sind und bleiben Naturereignisse», sagte der Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus an einem Medienanlass in Bern.
«Ich gehe davon aus, dass wir solche Extremereignisse wie im 2005, nie mit der Gewässerregulierung alleine in den Griff bekommen», sagte Luzius Thomi, Abteilungsleiter Gewässerregulierung vom Amt für Wasser und Abfall.
Gewässerregulierung müsse deshalb als Teil eines integralen Risikomanagements verstanden werden, das Massnahmen auf verschiedenen Ebenen vorsehe. Dazu gehörten neben Schutzbauten auch planerische und bauliche Massnahmen zur Reduktion des Schadenpotenzials.
Gewässerregulierung zeigt Wirkung
Dass die Gewässerregulierung sich bewährt habe und Wirkung zeige, demonstrierte der Kanton anhand des Hochwassers 2021. Gemäss Berechnungen des Kantons sorgten die Regulierungsmassnahmen dafür, dass die Wasserpegel im Thunersee 17 Zentimeter tiefer und im Bielersee 19 Zentimeter tiefer lagen, als wenn nicht reguliert worden wäre.
«Bei der Regulierung sind wir wahrscheinlich nahe am Optimum dessen, was wir mit den heutigen Mitteln tatsächlich machen können», sagte Thomi. «Alle Reden von KI. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann noch bessere Modelle haben.»
Im Kanton Bern lebt jede siebte Person in einer von Hochwasser gefährdeten Zone, so Thomi. 48’000 Gebäude im Kanton befinden sich in einer hochwassergefährdeten Zone. Das sind 15 Prozent aller Gebäude im Kanton Bern. «Ich bin überzeugt, dass die Bedeutung der Gewässerregulierung künftig noch zunimmt», sagte Neuhaus. «Der Klimawandel stellt uns vor zusätzliche Herausforderungen». So verursacht der Klimawandel beispielsweise Regenphasen mit grösseren Niederschlagsmengen in kürzerer Zeit.