
Samt und Sade

Zweideutiges im Kunsthaus Zürich: Mit der Ausstellung "SADE SURREAL - Der Marquise de Sade und die erotische Fantasie des Surrealismus" wird der Kunst-Winter samt und eindrücklich.
Wenn die Anzahl anwesender Journalistinnen und Journalisten auf die Wichtigkeit einer Ausstellung schliessen lässt, dann ist die Sade/Surreale eine schwergewichtige. Doch vielleicht streicht die beträchtliche Anzahl Medienvertreter einzig die ungebrochene Neugier an Erotik, Gewalt und Kunst heraus.
Marquise de Sade. Allein sein Name öffnet der Phantasie Vorzimmer und Schlafgemach. Als Hexenmeister der sexuellen Obsessionen, ungebändigter Freigeist, Lüstling und Wüstling beeinflusst sein Werk Literatur, Film, Kunst, Psychologie und die weltweite Pornoindustrie bis heute.
Salonfähiger Sade
Den Surrealisten kommt der Verdienst zu, Donatien Alphonse François Marquise de Sade (1740 – 1814) aus dem Kerker der Sexual-Pathologie befreit und in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts einem grösseren Publikum zugänglich gemacht zu haben. Und heute – wenn man dem Feuilleton Glauben schenken kann – gehört es, zumindest in Frankreich, zum guten Ton, einen de Sade im Büchergestell zu haben. Ob gelesen oder ungelesen, ist eine andere Frage.
In Schwarz und Rot, in Samt und Dämmerlicht präsentiert sich die von Kurator Toni Bezzola konzipierte Ausstellung im Zürcher Kunsthaus. Vorbei an Louis Buñuels «Belle de jour» aus dem Jahre 1966 locken rund 130 Kunstwerke und über 100 Original-Manuskripte aus der Feder des Libertins.
Zensur und Zitrone
Imposantes Kernstück bildet die in schwarzen Samt gehaltene 28 Meter lange Vitrine, in der öffentlich noch nie gezeigte Original-Manuskripte zu sehen sind. Zeugnisse von obsessiver Schreibwut, der Akribie der Zensur und deren erfinderischen Umgehung. Wir sehen die sichtbargemachten Zeilen zwischen den Zeilen, die Sade mit Zitrone schrieb. Seite um Seite, Tag für Tag, unermüdlich gegen seine über dreissig Jahre dauernde Gefangenschaft anschreibend.
«Es war», wie die beiden Zürcher Sadologen, Sade-Übersetzer und Mitarbeiter der Ausstellung Stefan Zweifel und Michael Pfister festhielten, «ein grosses dunkles Fest der Freude, diese Originale in Händen zu halten». Beide halten die Schriften keineswegs für verstaubte Reliquien, sondern als Schauplatz einer ewigen Revolte, als Aufbegehren gegen eine engstirnige Epoche, gegen aufklärerische Vernunft.
Je mehr die Zensur zuschlug, um so wilder wurden die Wortspiele, die Anspielungen, Zwei- und Mehrdeutigkeiten. Sade verfasste – nebst seinen Romanen – Onanieprotokolle, erstellte Listen über Geld, gelesene Bücher, Namenslisten für seine Romane, den Zustand seiner Wäsche. Und immer wieder das Böse, das Irrationale der Triebe. Er beschreibt, was niemand wahrhaben will und doch alle erahnen.
Die Surrealisten
So verstehen die Surrealisten Sades Werk nicht als Fallstudie eines pathologischen Triebes, sondern als künstlerische Gestaltung des Triebhaften. Das phantastische Reich der Phantasie ist grenzenlos, in seiner Spielfreude, in seiner Sexualität, wie auch in seiner Grausamkeit.
Als kriegsbildgewohnte und pornografiebewusste Gesellschaft steht man anfangs den ausgestellten Bildern mit einer kühlen abgeklärten Haltung gegenüber. Die verliert sich jedoch bald, wenn man sich getraut, genau und lange hinzuschauen, sich auszusetzen.
Die teilweise brutalen Bilder, die Fesselungen, Folterungen, der Sadismus gehen unter die Haut. Hans Bellmers handkolorierte Fotografien aus dem Jahre 1949 «Die Spiele der Puppe» zeigen monströs verformte Körperteile, nackt dargeboten in ihrer ganzen Verletzlichkeit. Daneben André Massons Zeichnungen (1928), federleichte Striche, die Gewaltbotschaften transportieren.
Man Rays schwarzweiss Fotografien sind ästhetische Abbilder für Männerphantasien. Alberto Giacomettis «Femme égorgée (Frau mit durchgeschnittener Kehle, 1932) vieldeutig, geheimnisvoll, undurchsichtig. René Margritte, ist immer wieder eine Entdeckung wert. Andere Werke lassen in ihrer ganzen Farbigkeit die spielerische Variante von Eros und Schmerz gelten.
Sades brutal-geile Welt war nie eine heile Welt. Er, der gegen die Obrigkeit, die Kirche, die Heuchelei anschrieb, der als junger Provinzadliger hemmungslos seine Obsessionen auslebte und in Gefangenschaft ein wortgewaltiges Werk schuf, kann nicht verdrängt werden. Ob wir es mögen oder nicht: Fast 200 Jahre nach seinem Tod ist der Sade-ismus noch immer allgegenwärtig.
Brigitta Javurek

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards















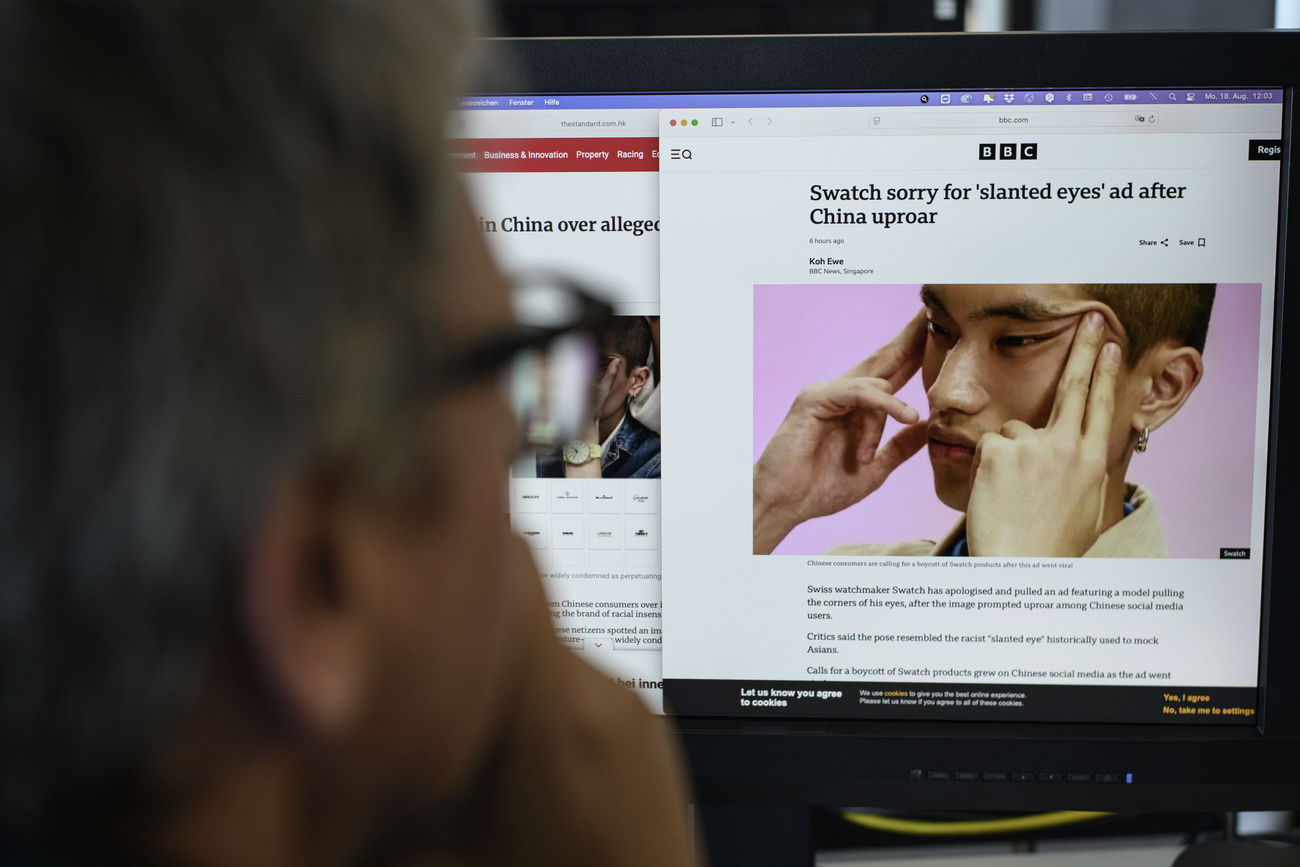



















Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch