
Die Gräuel von Myanmar: Handyvideos liefern der UNO Beweise

UNO-Ermittler Nicholas Koumjian erklärt, wie sein Team trotz schwindender finanzieller Ressourcen Gräueltaten in Myanmar dokumentiert – von massenhafter sexueller Gewalt bis hin zu Luftangriffen auf Zivilisten – und Beweise für künftige Strafverfolgungen vorbereitet.
Nicholas Koumjian hat sein gesamtes Berufsleben lang für Gerechtigkeit in Bosnien, Sierra Leone, Osttimor und Kambodscha gekämpft. Von Genf aus erklärt er, warum Myanmar ein Sonderfall ist.
Der wichtigste Grund für diese Sonderstellung ist die schiere Menge an digitalen Beweisen für Verbrechen gegen die Rohingya, einer muslimischen Minderheit, die in dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit langem verfolgt wird.
Seit 2016, als das damalige Militärregime brutale «Säuberungsaktionen» gegen diese Minderheit startete, wurden etwa 720’000 Menschen zur Flucht gezwungen.
«Der Einsatz von Technologien macht einen der grössten Unterschiede», sagt Koumjian. «Die Rohingya waren zwar sehr arm, aber sie besassen alle Telefone. Wir haben Tausende von Videos gesammelt, die sie mit ihren Handys aufgenommen haben, als ihre Dörfer niedergebrannt wurden.»
Diese Gräueltaten sind ein Schwerpunkt des «Unabhängigen Untersuchungsmechanismus für Myanmar» (IIMM), den Koumjian leitet. Der Mechanismus wurde 2018 vom UNO-Menschenrechtsrat ins Leben gerufen und hat die Aufgabe, Beweise für die schwersten internationalen Verbrechen zu sammeln und zu sichern, die seit 2011 in dem Land begangen wurden.
Für Koumjian veranschaulicht die Flut an Handyaufnahmen und Social-Media-Posts von Überlebenden vergangener und aktueller Verbrechen in Myanmar sowohl das Potenzial als auch die Probleme dieser Arbeit.
Millionen digitaler Daten
Der Zugang zu Echtzeit-Beweisen ist beispiellos, und damit zugleich die Herausforderung, Millionen digitaler Objekte zu sichten, zu authentifizieren, zu speichern und zu übersetzen.
«Durch die Menge an Material, die wir sammeln, verfügen wir über Millionen von Objekten, von einem Foto bis zu einem 300-seitigen Bericht», sagt Koumjian. «Ein Grossteil unserer Daten stammt aus den sozialen Medien.»

Seit 2020 ist eine spezialisierte Open-Source-Ermittlungseinheit unverzichtbar geworden. Digital-Detektivinnen und Detektive durchsuchen das Internet nach Videos, Bildern und Beiträgen und ordnen diese dann mithilfe von Geolokalisierungs- und Chrono-lokalisierungs-Tools genauen Orten und Zeitpunkten zu.
Das Team verfolgt auch Online-Äusserungen, die Absichten oder eine Befehlsverantwortung offenlegen, und folgt den digitalen Spuren derjenigen, die Hassreden gegen die Rohingya schüren. Es ist eine akribische Arbeit, die aus vereinzelten Pixeln gerichtsreife Beweise macht.

Mehr
Das Internationale Genf
Künstliche Intelligenz als Ermittlungshilfe
«Wenn in den sozialen Medien ein Video von der Hinrichtung Gefangener kursiert – und das ist uns schon mehrmals passiert –, kann [die Einheit] viel damit anfangen», sagt Koumjian.
«Sie kann herausfinden, wann das Video zum ersten Mal in den sozialen Medien aufgetaucht ist, die Quellen identifizieren und umfangreiche Recherchen durchführen.»
Künstliche Intelligenz könnte die Strafverfolgung schon bald grundlegend verändern und beschleunigen. «Mit der zunehmenden KI werden wir sogar in der Lage sein, Anfragen mithilfe von KI zu stellen», sagt er. Zum Beispiel: «Zeig mir alle Beweise, in denen diese Person erwähnt wird, oder auch kompliziertere Fragen.»
Eine der wichtigsten Aufgaben des Open-Source-Teams ist es, Videos und Fotos zu überprüfen und zu authentifizieren, um festzustellen, ob sie echt oder gefälscht sind.
Was ist echt und was ist fake?
Mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie werden jedoch auch neue Herausforderungen entstehen. «Was echt ist und was Fake News sind – das wird immer schwieriger zu unterscheiden sein», sagt er.
Letztendlich kann Technologie nicht alles lösen. Im Gegensatz zu Bosnien, wo die Nato Gerichtsbeschlüsse durchgesetzt hat, besitze die IIMM keinen Zugang zu Myanmar und müsse vollständig vom Ausland aus arbeiten, erklärt der Ermittler.
Und anders als in Konflikten mit zwei klaren Seiten sind an dem Krieg in Myanmar eine Vielzahl von Akteuren beteiligt: die Armee, Milizen und bewaffnete Oppositionsgruppen, die alle wegen Gräueltaten angeklagt sind. Jeder von ihnen erzeugt seine eigenen Beweise.

Verbrechen in Haftanstalten – ein Weg zur Verurteilung
Angesichts der vielen zu untersuchenden Gräueltaten muss das IIMM konkurrierende Prioritäten abwägen. Haftbezogene Verbrechen seien zu einem zentralen Schwerpunkt geworden, sagt Koumjian, da sie oft die eindeutigsten Hinweise lieferten.
Dieser Schwerpunkt spiegle sich auch im jüngsten Jahresbericht des Mechanismus wider: «Die Menschen kennen oft den Namen oder können die Person identifizieren, die sie oder andere Menschen in ihrem Gefängnis gefoltert hat», sagt er.
«Die Gefangenen kennen oft den Gefängniskommandanten oder die Vernehmer. Oder es liegen uns andere Aufzeichnungen vor, die belegen, wer in diesem Gefängnis die Befehle erteilt.»
Zeugenaussagen beschreiben Elektroschocks, Schläge, Strangulation, Verbrennungen und Gruppenvergewaltigungen, besonders in inoffiziellen Haftanstalten, die von der Aussenwelt abgeschirmt sind.
Koumjian sagt, dass an diesen Orten oft die schlimmsten Misshandlungen geschehen. Die Vernehmer drängen auf falsche Geständnisse und Frauen sind ständig mit sexueller Gewalt bedroht, wenn sie sich weigern, zu kooperieren.
«Es gibt zumindest die implizite Drohung, dass es zu sexuellen Übergriffen kommt, wenn sie nicht kooperieren», sagt er.
Sexuelle Gewalt als Muster
Sexuelle Gewalt ist seit langem ein Kennzeichen der myanmarischen Militär-Operationen. In den so genannten Säuberungskampagnen gegen die Rohingya in den Jahren 2016 und 2017 war dieses Muster systematisch.
«Es war vielleicht das Schlimmste, was ich in all diesen Konflikten gesehen habe», sagt Koumjian über das Ausmass der sexuellen Gewalt in dieser Zeit.
Die Ermittelnden untermauerten die Aussagen der Überlebenden, indem sie mit medizinischem Personal sprachen, das Genitalverletzungen, Schwangerschaften nach Vergewaltigungen und Abtreibungswünsche behandelt hatte.

Die Dokumentation solcher Verbrechen aus der Distanz bleibt schwierig. Viele Befragungen werden aus Sicherheitsgründen aus der Ferne durchgeführt, oft mit Hilfe lokaler zivilgesellschaftlicher Gruppen, die den ersten Kontakt zu den Zeuginnen und Zeugen herstellen.
Das IIMM vermittelt Überlebenden nach Möglichkeit psychologische Unterstützung. Koumjian weist jedoch darauf hin, dass der Zuschuss für Zeugenschutz und psychosoziale Unterstützung, einschliesslich der Verlegung von Zeuginnen und Zeugen in seltenen Fällen, ausgelaufen ist. «Dafür haben wir im Moment kein Geld», sagt er.
Gräueltaten mit Myanmars Führungsspitze in Verbindung bringen
Letztendlich müssen die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht nur beweisen, dass Gräueltaten begangen wurden, sondern auch, dass die Verantwortung dafür auf höchster Ebene liegt. Das ist die schwierigste Verbindung, die es herzustellen gilt.
«Das Schwierige daran ist zu zeigen, warum diese hochrangige Person für ein Verbrechen in einem Dorf verantwortlich ist, in dem sie vielleicht noch nie gewesen ist, für ein Verbrechen gegen eine Frau und ihre Familie, die sie nie getroffen hat, begangen von einem Täter, mit dem sie nie gesprochen hat», sagt Koumjian.
«Es geht darum, Beweise zu sammeln, die das Wissen der höheren Ebenen, das von ihnen zugelassene Verhalten und die verschiedenen Befehle belegen, die sie erteilt haben.»
Frühere Tribunale haben gezeigt, dass dies möglich ist. Charles Taylor, von 1997 bis 2003 Präsident von Liberia, wurde wegen Beihilfe zu den Gräueltaten der Rebellen in Liberia verurteilt, und die Führer der Roten Khmer in Kambodscha wurden für Morde zur Verantwortung gezogen, die sie nie direkt begangen, sondern angeordnet oder ermöglicht hatten.
Die Beweise des Mechanismus flossen bereits in den Antrag des Internationalen Strafgerichtshofs auf einen Haftbefehl gegen Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing ein, der seit 2021 Herrscher von Myanmar ist. Gegen ihn und 24 weitere Verdächtige liegt zudem ein Haftbefehl des argentinischen Bundesstrafgerichtshofs vor.

Doch Gerechtigkeit braucht Zeit. Im Fall des Khmer-Rouge-Tribunal in Kambodscha wurden die Urteile erst vier Jahrzehnte nach den Verbrechen gefällt. «Wir wollen nicht 40 Jahre warten, aber es ist sehr schwer vorherzusagen, wann und wo Gerechtigkeit hergestellt werden kann», warnt Koumjian.
In der Zwischenzeit wächst das Archiv und umfasst mittlerweile 600 Augenzeugenberichte, Millionen von Dokumenten, Fotos, Videos und Satellitenbilder. Finanzierungslücken bedrohen jedoch die Spezialeinheiten für sexuelle Gewalt, Verbrechen gegen Kinder und Open-Source-Intelligenz.
Koumjian betont jedoch, dass es bei seiner Arbeit nicht nur um zukünftige Prozesse geht, sondern auch um die Gegenwart. «Wir üben Druck auf diese Täter und potenzielle Täter aus, damit sie sie sich eines Tages vor Gericht verantworten müssen.»
Folter und sexuelle Gewalt in Haft – Hinweise auf Schläge, Elektroschocks, Strangulation, Gruppenvergewaltigungen und Verbrennungen an Geschlechtsteilen, besonders in inoffiziellen Einrichtungen. Die für diese Haftanstalten verantwortlichen Kommandanten wurden identifiziert.
Aussergerichtliche Tötungen – verübt von Myanmars Sicherheitskräften, angeschlossenen Milizen und oppositionellen bewaffneten Gruppen an gefangenen Kämpfern und mutmasslichen Informant:innen.
Luftangriffe auf Zivilpersonen – Ziel waren Schulen, Märkte, Spitäler und Moscheen, darunter auch während der Erdbebenrettungsmassnahmen im März 2025, mutmasslich unter Verstoss gegen das Kriegsrecht.
Ethnische Verfolgung – neue Ermittlungen zu Gräueltaten im Bundesstaat Rakhine im Zug der Zusammenstösse zwischen dem myanmarischen Militär und der Arakan Army, parallel zu den laufenden Ermittlungen zu Verbrechen gegen die Rohingya in den Jahren 2016-2017.
Austausch von Beweismaterial – Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof, dem Internationalen Gerichtshof, Argentinien und den Behörden des Vereinigten Königreichs, Beitrag zu internationalen Haftbefehlen und Gerichtsverfahren.
Editiert von Virginie Mangin/gw, Übertragung aus dem Englischen mit der Hilfe von Deepl: Petra Krimphove

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards




























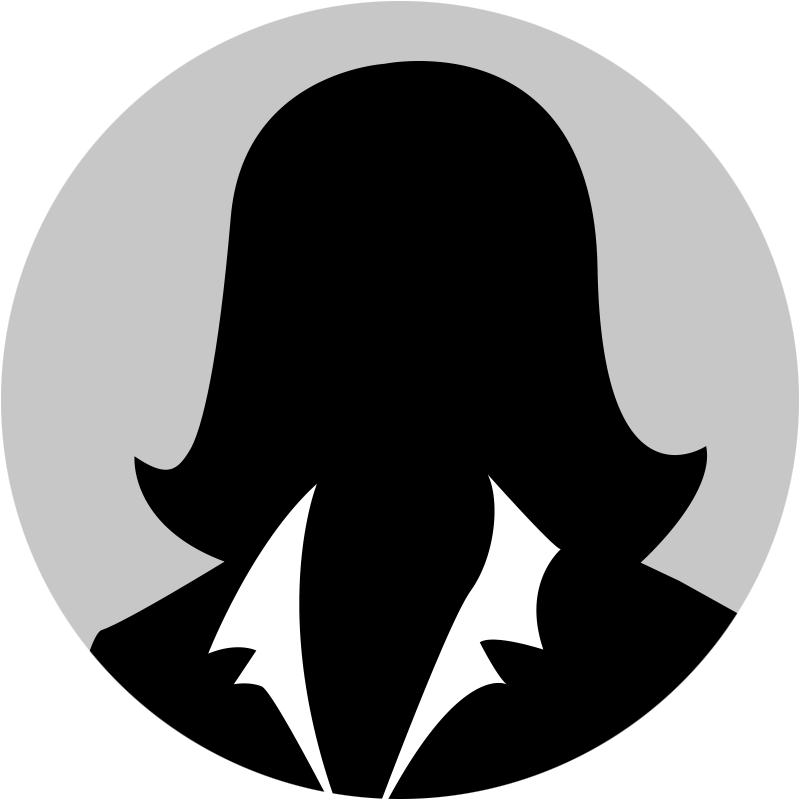
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch